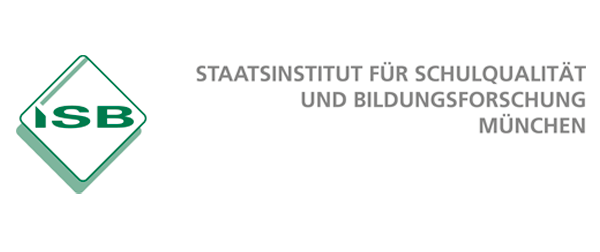Fragestellungen der Studie:
- Wie ist das Wohlbefinden von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Laborschule Bielefeld und durch welche schulischen Strukturen wird es beeinflusst?
Rezension zur Studie
Geist, S., Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Siepmann, C. (2019). Subjektive Wahrnehmung von Inklusion durch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Laborschule Bielefeld. In C. Biermann, S. Geist, H. Kullmann & A. Textor (Hrsg.), Inklusion im schulischen Alltag. Praxiskonzepte und Forschungsergebnisse aus der Laborschule Bielefeld (Impuls Laborschule, Band 10) (S. 235–259). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.FIS BildungDas Team um Sabine Geist untersucht anhand von fünf umfangreichen teilstandardisierten Interviews von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ob sich diese an der Laborschule Bielefeld als sozial integriert und unterstützt wahrnehmen und welche schulischen Strukturen zu ihrem Wohlbefinden beitragen oder dieses beeinträchtigen. Das Wohlbefinden ziehen die Autorinnen und Autoren hierbei als Indikator für eine gelingende Inklusion heran. Geist et al. ermitteln durch Analyse der Interviews das Wohlbefinden auf drei Ebenen:
- innerpsychische Ebene: Die Schülerinnen und Schüler verstehen sich als vollwertige Mitglieder ihrer Stammgruppe, finden dort Freunde und können mit Lehrkräften über ihre Situation sprechen. Jedoch kommt es durch ungenaue Passung von Arbeitsaufgaben gelegentlich zum Gefühl der Überforderung.
- interaktionelle Ebene: Die Stammgruppe (und später der Jahrgang) hilft beim Lernen und bei Lebensproblemen. Das Verhältnis zu Lehrkräften ist insgesamt vertrauensvoll, jedoch fühlen sich die Jugendlichen nicht immer ausreichend von den Lehrkräften unterstützt und empfinden Versammlungssituationen häufig als problematisch.
- institutionelle Ebene: Die schulisch verankerten Unterstützungsstrukturen (Arbeit mit Sonderpädagoginnen und -pädagogen, Klassenfahrten, Projekte, Arten der Leistungsdifferenzierung) werden als hilfreich erlebt.
Insgesamt entsteht ein positives Bild der Inklusion an der Laborschule.
Die Untersuchung gibt ein detailliertes Bild der Inklusion an einer Schule und zeigt auf methodisch adäquatem Weg Faktoren auf, welche zum Wohlbefinden und damit zum Gelingen der Inklusion beitragen. Insofern erscheint die Untersuchung inhaltlich sinnvoll und methodisch passend. Allerdings liegen den Auswertungen nur 5 ausgewählte Interviews zugrunde, was hinsichtlich der abgeleiteten Aussagen eine mangelnde Repräsentativität und eine geringe Generalisierbarkeit wahrscheinlich macht. Zudem werden die Strukturen der Laborschule nicht ausreichend erläutert, wodurch offenbleibt, inwiefern die Ergebnisse auf andere Schulen übertragbar sind. Auch wird die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf nur sehr oberflächlich charakterisiert, so dass für eine weitere Differenzierung der vorgelegten Ergebnisse umfangreiche weitere Forschungsarbeiten notwendig sind.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Fühle ich mich der Aufgabe „Inklusion“ gewachsen?
- Wie kann ich – etwa durch Gespräche mit den betroffenen Jugendlichen – noch bestehende Problemfelder im Bereich Inklusion ermitteln?
- Wie offen stehe ich Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf gegenüber: Wie sehr bin ich z. B. bereit, diese zu fördern, ggf. unabhängig davon, ob sie zu „meiner“ Klasse gehören oder nicht?
- Welchen Einfluss habe ich darauf, ob sich Schülerinnen und Schüler an der Schule wohlfühlen?
- Wie gut gelingt es mir, Aufgaben im Hinblick auf Inhalt und Zeitbedarf individuell an die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler anzupassen?
- Welche Abläufe an der Laborschule würde ich gerne in meinen Alltag übertragen?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Welche Möglichkeiten habe ich, um zum Gelingen von Inklusion beizutragen?
- Welche strukturellen Gegebenheiten müssen für dieses Ziel angepasst werden?
- Sind die Lehrkräfte an meiner Schule ausreichend ausgebildet, um zu erkennen, wo von der Seite betroffener Schülerinnen und Schüler Handlungsbedarf im Bereich Inklusion besteht?
- Gibt es „good practice-Beispiele“, die als Modell für gelingende Inklusion dienen können?
- Welche Bedeutung räume ich dem Faktor „Wohlbefinden“ an meiner Schule ein?
Die Studie von Geist et al. untersucht die Inklusionsbestrebungen an der Laborschule Bielefeld anhand von Interviews, in denen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dazu Stellung beziehen, ob und in welchen schulischen Situationen sie sich (nicht) wohlfühlen. Die Untersuchungen erfolgen zum einen vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren bundesweit die Anstrengungen intensiviert wurden, die schulische Inklusion voranzubringen. Zum anderen gibt es an der Laborschule selbst bereits (unsystematische) Beobachtungen, die auf eine weitgehend gelingende Inklusion hindeuten, aber bislang weder wissenschaftlich abgesichert, noch systematisch ausgewertet wurden. Inklusionsfördernde und -hemmende Faktoren sind an der Laborschule also noch nicht hinreichend identifiziert.
Auf der Basis bisheriger Untersuchungen ist davon auszugehen, dass soziale Integration und Unterstützung zu schulischem Wohlbefinden beitragen und das Wohlbefinden wiederum ein Zeichen einer gelingenden Integration ist. Bisherige Forschungsergebnisse deuten hierbei darauf hin, dass bei inklusiv beschulten Lernenden die in Befragungen festgestellten Werte der sozialen Integration und Partizipation in der Regel bei den Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf weniger günstig sind als bei solchen ohne Förderbedarf (z. B. Huber, 2009). Das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf kann somit als vergleichsweise gering angenommen werden. Im Kontrast dazu stehen jedoch die Befunde an der Laborschule: Hier sind die Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf nur sehr gering – auch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geben hohe Werte im Wohlbefinden an (Kullmann, Geist & Lütje-Klose, 2015).
Hieraus leiten Geist et al. die für die Untersuchung maßgebliche Fragestellung ab: Nehmen sich Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Laborschule als sozial integriert und unterstützt wahr, besuchen sie die Schule gerne und fühlen sie sich dort wohl? Insbesondere möchten die Autorinnen und Autoren untersuchen, welche schulischen Faktoren zu einem erhöhten oder geminderten Wohlbefinden beitragen.
Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojekts „Wohlbefinden und Inklusion an der Laborschule – eine Selbstreflexion (WILS-FEP)“, das auf eine systematische Analyse der alltäglichen Praxis an der Laborschule abzielt und hierzu qualitative und quantitative Verfahren verwendet. Die vorliegende Untersuchung geht auf eine rein qualitative Teilstudie zurück, welche Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 betrachtet, für die zumindest zeitweilig Förderbedarf bestand.
Stichprobe
Die Erhebung bezieht sich ausschließlich auf Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Bislang nahmen Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Jahrgangsstufe an der Untersuchung teil. Die Aussagen zu Schulerfahrungen unter besonderer Berücksichtigung des schulischen Wohlbefindens wurden in acht Interviews erhoben, von denen fünf im Beitrag von Geist et al. Berücksichtigung fanden. Die fünf interviewten Jugendlichen (zwei Mädchen, drei Jungen) gehören den Jahrgangsstufen 9 und 10 an. Alle besuchten die Laborschule seit dem Vorschuljahr („Jahrgangsstufe 0“) und wiesen von Anfang an erhebliche Schwächen bei der Verarbeitung kognitiver Lerninhalte oder in Bezug auf die emotional-soziale Entwicklung auf.
Erhebungsinstrumente
Die Datenerhebung erfolgte in Form von teilstandardisierten Interviews auf der Basis eines Leitfadens, der vom Projektteam erstellt worden war. Zu diesem Leitfaden lagen bereits einige Vorarbeiten vor: So wurde zum einen im Rahmen einer Serie von Masterarbeiten auf induktivem Weg ein Kategoriensystem für eine qualitative Inhaltsanalyse erarbeitet, das von der Forschergruppe weiterentwickelt wurde. Auf dieser Basis erfolgte auch eine Reanalyse der Interviews. Zum anderen gingen Aspekte in den Interviewleitfaden ein, die sich aus einer vorangegangenen quantitativen Studie sowie aus Beobachtungen der am WILS-FEP beteiligten Kolleginnen und Kollegen ergaben.
Die Interviews selbst erfolgten während der Schulzeit. Sie dauerten durchschnittlich eine Stunde. Das Maß an Auskunftsbereitschaft und Reflexionsvermögen wird von Geist et al. als „auffällig“ hoch beschrieben und war von Aussagen geprägt, die auch selbst- und systemkritische Aspekte umfassten. Die Interviews wurden jeweils von einer studentischen Mitarbeiterin und einem Sonderpädagogen durchgeführt.
Auswertung
Die Auswertung erfolgte ausschließlich qualitativ in Anlehnung an das Analyseverfahren von Mayring (2010). Den Ansatz von Reiser, Klein, Kreie und Krön (1986) als theoretisches Rahmenkonzept aufgreifend, berücksichtigte die Auswertung drei inhaltliche Ebenen:
- innerpsychisch: Einstellungen zur Schule, Selbstwahrnehmung, Wohlbefinden, Probleme/Hilfeerleben in der Schule
- interaktional: Schule als Unterstützungssystem, Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern, Beziehungen zu Lehrkräften
- institutionell: Unterrichts-/Lernzeit, schulische bzw. nachschulische Angebote und Strukturen, Kooperationspartnerinnen und -partner
Die Autorinnen und Autoren schränken jedoch ein, dass die im Rahmen der Auswertung notwendige klare Trennung dieser Ebenen aufgrund von Überschneidungen oder wechselseitigen Einflüssen als schwierig anzusehen ist.
Auf der innerpsychischen Ebene registrieren Geist et al. eine positive Grundeinstellung aller befragten Schülerinnen und Schüler zur Schule und heben eine als angenehm wahrgenommene Atmosphäre und eine Kultur des Willkommenseins hervor. So bestehe u. a. ein guter Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern, der Probleme zu bewältigen helfe und entlastend wirke. Auch der Kontakt zu den Lehrkräften wird als positiv bewertet, insbesondere im Hinblick auf den respektvollen Umgang und das Ziehen von Grenzen. Gelegentlich werden in den Interviews auch Lieblings- oder Rückzugsorte an der Schule thematisiert. Kritisch gesehen werden die als hoch bewerteten Leistungsanforderungen, zumal Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufig die im Unterricht nicht bewältigten Aufgaben als Hausaufgaben in ihrer knappen Freizeit bearbeiten müssten – ein Vorgehen, das eigentlich an der Ganztagsschule nicht üblich ist.
Dafür sei nach Geist et al. zudem ein hohes Niveau an Selbstorganisation erforderlich, über welches die Jugendlichen teils noch nicht in ausreichendem Maße verfügten. Zudem fehle den Schülerinnen und Schülern z. T. die Bereitschaft, die eigenen Ergebnisse auf der Ebene des individuellen Fortschritts (und nicht an der sozialen Norm des Klassenmaßstabs orientiert) einzuschätzen und anzunehmen. Dieses Problem steigere sich, sobald ab dem 8. Jahrgang Schulabschlussprognosen gestellt werden (wodurch die individuelle Ebene weiter zurückgedrängt werde) und auch dann, wenn überzogene Elternerwartungen bestünden.
Aus den bestehenden kritischen Bewertungen leiten Geist et al. die Notwendigkeit ab, eine bessere, individualisierte Passung der Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten von Aufgaben im Kollegium zu erarbeiten.
Hinsichtlich der interaktionellen Ebene thematisieren die Schülerinnen und Schüler positive Erfahrungen, z. B. den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung (v. a. in ihrer Stammgruppe). Bezüglich der Lehrkräfte wird hervorgehoben, dass diese für entlastende Gespräche und Problemlösungen in einem Klima der Offenheit und Ernsthaftigkeit zur Verfügung stünden. Zwiespältig bewerten befragte Schülerinnen und Schüler die sogenannte Versammlungssituation, ein kreisförmiges Plenumsgespräch auf Augenhöhe, welches thematisch breit gestreut ist und zugleich ein pädagogisch-didaktisches Kernelement der Laborschule darstellt.
Hierbei sei der Grat zwischen Akzeptanz und Beschämung schmal, sodass diese Situation sowohl als herausfordernd als auch als beängstigend erlebt werden könne. Auch gelinge es den Lernenden mit Förderbedarf nicht immer, den Gesprächen in angemessenem Umfang zu folgen. Zudem gehe durch das Plenum Zeit verloren, welche die Schülerinnen und Schüler eher für die Bearbeitung individueller Aufgaben einsetzen könnten. Andererseits könnten in den Versammlungen auch Probleme im vertrauten Kreis offen thematisiert werden. Problematisch ist, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht von allen Lehrkräften ausreichend unterstützt und gefördert fühlen.
In Bezug auf die von den Schülerinnen und Schülern genannten Problemfelder regen Geist et al. an, die Selbstkompetenz der Lehrkräfte (im Rahmen von Fortbildungen) zu erweitern und das Ritual der Versammlungen kritisch zu überprüfen.
Hinsichtlich der institutionellen Ebene schränken Geist et al. zunächst ein, dass die Befragten bei ihren Interviews die Laborschule nicht unbedingt als eigenständiges System im Blick gehabt hätten. Trotzdem ließen sich die Antworten auch im Hinblick auf die institutionelle Ebene auswerten, etwa zu den Lern- und Unterstützungsangeboten und zu Formen der Leistungspräsentation und -bewertung.
Als positiv bewerten die Jugendlichen, dass sie Personen, die ihnen helfen sollen, frei wählen dürfen und sie hierbei neben Lehrkräften auch auf andere Erwachsene (z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sozial- und sonderpädagogischen Bereichs) zurückgreifen können. Auch die Möglichkeit der Schülerinnen und Schüler, im Rahmen von z. T. frei gewählten strukturell verankerten Angeboten (z. B. Theaterprojekte, Fahrradführerschein, Berufsberatungsmaßnahmen, Jahresarbeiten) eigene Stärken zu entdecken und ein positives Selbstbild entwickeln zu können, wird als positiv wahrgenommen. Allerdings beklagen sie manchmal die damit verbundene Mehrbelastung. Weitere positive Bewertungen stehen im Zusammenhang mit der großen Vielfalt von Methoden der Leistungspräsentation (und –bewertung) sowie – eingeschränkt – auch mit Klassenfahrten.
Für das im Rahmen der Untersuchung festgestellte Problem, dass einigen Schülerinnen und Schülern durch die ab der neunten Jahrgangsstufe üblichen Notenzeugnisse gespiegelt werden muss, dass sie evtl. die eigenen, (zu) hoch gesteckten Erwartungen nicht erreichen, können Geist et al. aufgrund der gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen keine Lösungen anbieten.
Insgesamt bestätigt die Untersuchung somit die bislang eher intuitive Annahme einer weitgehend gelingenden Inklusion an der Laborschule, sie zeigt aber auch Felder für zukünftige Entwicklungen auf.
Die Untersuchung von Geist et al. steht im Kontext der in den letzten Jahren auf breiter Basis intensivierten Bemühungen, die Inklusion an Schulen voranzubringen. Das Thema ist somit hochaktuell. Anhand von Interviews betrachtet sie die Inklusion durch die Augen der betroffenen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und fokussiert dabei auf den – für das Gelingen der Inklusion wichtigen – Faktor des Wohlbefindens. Auf diese Art und Weise gelingt es auf drei Ebenen, eine Reihe von Aspekten zu identifizieren, welche das Wohlbefinden fördern oder beeinträchtigen können.
Diese Aspekte können gegebenenfalls auch von größtem Interesse für andere Schulen sein, welche versuchen, gute Bedingungen für Inklusion zu schaffen. Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit von Geist et al. sehr zu begrüßen. Auch die gründliche Vorbereitung der Untersuchung, etwa durch die umfangreiche Erarbeitung des Interviewleitfadens, ist eine Stärke der Untersuchung.
Kritisch anzumerken ist, dass die Zahl der interviewten Personen gering ist und nur wenige Details zur Stichprobe vorliegen: Von insgesamt acht vorliegenden Interviews werden nur fünf in die Arbeit einbezogen. Ob diese eine gewisse Repräsentativität für die Gruppe der Schülerinnen und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf haben und damit ihre Eindrücke für eine zukünftige Nutzung verallgemeinert werden können, ist nicht bekannt und als eher unwahrscheinlich anzusehen. Auch bleiben drei Dimensionen nicht hinterfragt:
- Es gibt unterschiedliche Ursachen für und Arten von Förderbedarf, dieser kann z. B. eher im kognitiven oder im emotional-sozialen Bereich liegen (und in beiden Bereichen weiter differenziert werden). Zeigen sich für diese beiden „Gruppen“ unterschiedliche Bewertungen der schulischen Strukturen und Prozesse? Fühlen sie sich in den identischen Kontexten gleichermaßen wohl oder unwohl? Falls dies nicht der Fall ist: Welche sinnvollen zusätzlichen Individualisierungen des schulischen Lebens sind erforderlich und möglich?
- Ein besonderer Förderbedarf kann in unterschiedlichem Ausmaß ausgebildet sein. Werden die schulischen Kontexte von Schülerinnen und Schülern mit sehr starkem besonderem Förderbedarf ähnlich wahrgenommen wie von Schülerinnen und Schülern mit weniger ausgeprägtem besonderem Förderbedarf? Wie ausgeprägt ist der besondere Förderbedarf bei den in der Studie befragten Jugendlichen?
- Es werden ausschließlich Interviews von Jugendlichen verwertet, die kurz vor dem Ende ihrer schulischen Laufbahn an der Laborschule stehen. Die Wahl von nur einem Untersuchungszeitpunkt geht dabei mit Einschränkungen einher: Zum einen könnte sich das Wohlbefinden – etwa durch Gewöhnung an die schulischen Gegebenheiten – im Laufe der Schuljahre verändert haben. Aus der Untersuchung lassen sich also keine Schlussfolgerungen über die Entwicklung des Wohlbefindens an der Laborschule ableiten. Hierzu müssten zusätzlich die Ergebnisse der im Projekt ebenfalls durchgeführten quantitativen Längsschnittanalysen herangezogen werden. Zum anderen erscheint es möglich, dass es Schülerinnen oder Schüler mit besonderem Förderbedarf gibt, die vor dem Erreichen der neunten Jahrgangsstufe die Schule gewechselt haben, da sie von den Verhältnissen an der Laborschule enttäuscht waren. Eine Analyse der Beweggründe dieser Gruppe könnte zu vertieften Einsichten in Bereiche führen, die im Hinblick auf das Ziel einer gelingenden Inklusion noch problematisch bzw. verbesserungswürdig sind.
Ein generell hervorzuhebender Kritikpunkt der Studie sind die mangelnden Details im Hinblick auf den schulischen Alltag an der Laborschule. Die Gegebenheiten an der Laborschule bleiben im Rahmen der Untersuchung recht unklar. Beispielsweise ist schwer zu beurteilen, wie genau die „Versammlungen“ an der Schule organisiert sind. Zudem scheinen sich die schulischen Abläufe und Ressourcen (soweit nachvollziehbar) spürbar von vielen anderen Schulen zu unterscheiden, was bereits durch den Namen „Laborschule“ deutlich wird. Die Besonderheiten sind aber nur schemenhaft erkennbar. So erfährt man nicht, ob bzw. inwieweit die pädagogischen Abläufe, die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler, die Auswahlkriterien der Lehrkräfte, die Schulform, die Ausstattung mit Personal und Material usw. Besonderheiten aufweist.
Ein vertieftes Verständnis der Arbeitsweisen und Abläufe wäre jedoch wichtig, um aus den Ergebnissen verallgemeinerbare Schlussfolgerungen für andere Schulen abzuleiten. Eine Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf die Gegebenheiten an anderen Schulen erscheint zumindest fragwürdig. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, an einer viel größeren Zahl organisatorisch unterschiedlicher Schulen Untersuchungen wie an der Laborschule durchzuführen, um die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte und Folgeschritte im Bereich Inklusion besser erfassen zu können. Es ist jedoch fraglich, wie dies organisatorisch umzusetzen wäre.
Somit deutet sich auf einer ganzen Reihe von inhaltlichen Feldern ein umfangreicher zukünftiger Forschungsbedarf an, um zu klären, wie Inklusion (noch besser) gelingen kann. Dies schmälert den Wert der Untersuchung von Geist et al. als mögliche Pilotstudie zu diesem Themenkomplex jedoch nicht. Die Studie leistet mit ihrem qualitativen Charakter erste Anhaltspunkte für Gelingensfaktoren von Inklusion und kann somit als „Startpunkt“ für weitere Forschung in diesem Bereich dienen.
Schulentwicklung NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Sie haben Fragen oder Anregungen?
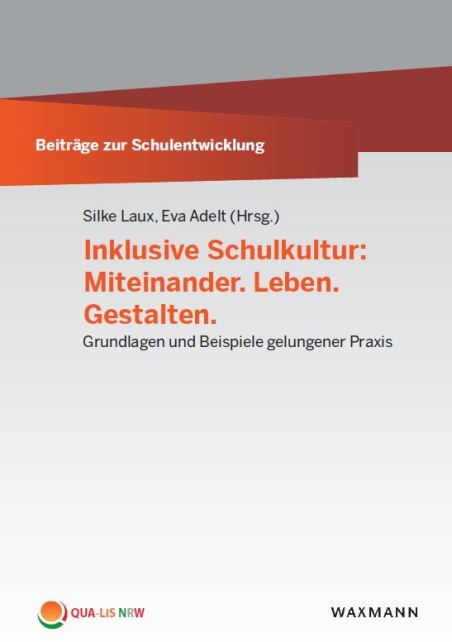 Inklusive Schulkultur
Inklusive Schulkultur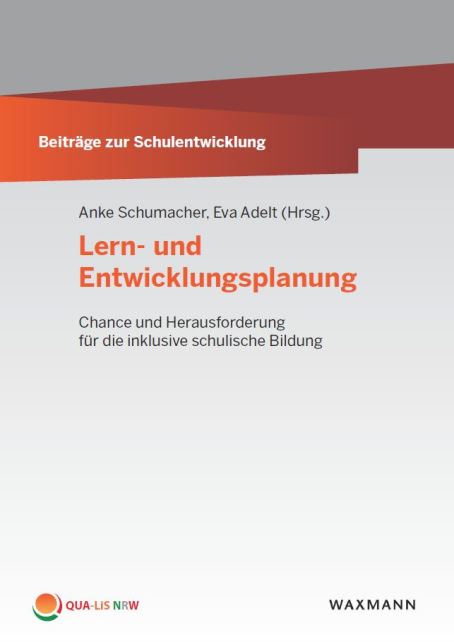 Lern- und Entwicklungsplanung
Lern- und Entwicklungsplanung