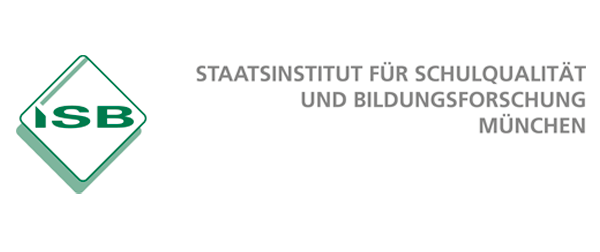Fragestellungen der Studie:
- Welche Gründe sprechen aus Sicht von Schulleitungen und Lehrkräften für oder gegen eine Nutzung bestimmter evidenzbasierter Wissensbestände?
- Inwiefern und in welchem Ausmaß werden verschiedene Datenquellen in der Schulpraxis tatsächlich genutzt?
Rezension zur Studie
Demski, D. (2018). Welche Wissensbestände nutzen Akteure in der Schulpraxis? Eine empirische Überprüfung des Paradigmas einer evidenzbasierten Schulentwicklung. In K. Dossel & B. Eickelmann (Hrsg.), Does „What works“ work? Bildungsforschung, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog (S. 101–116). Münster: Waxmann.FIS BildungDie Untersuchung stellt eine Reaktion auf das Paradigma einer evidenzbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung dar, indem die Autorin per Fragebogen erfasst, von welchen - z.T. standardisiert erhobenen - Wissensbeständen („Evidenzquellen“) sich 1.230 Lehrkräfte und 297 Mitglieder der Schulleitung an sechs Schulformen in Rheinland-Pfalz welches Ausmaß an Nutzen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung versprechen und in welchem Umfang diese Quellen tatsächlich genutzt werden. In 35 Interviews von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern an Schulen mit auffällig hoher oder niedriger Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände wird zudem der Frage nachgegangen, was dazu beiträgt, den Gebrauch von Evidenzquellen zu fördern oder zu behindern. Dabei wird der Begriff Evidenzquelle weit gefasst und enthält so heterogene Informationen wie Ergebnisse aus Vergleichsarbeiten, Schülerfeedback, Fachzeitschriften, Befunde aus Schulinspektionen, Beobachtungen bei kollegialer Hospitation usw.
Die Autorin ermittelt die Einschätzung der Nützlichkeit der verschiedenen Evidenzquellen und das Ausmaß ihrer Nutzung durch Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder und weist deren Gründe dafür aus, Evidenzquellen in unterschiedlichem Umfang zu nutzen: So werden z.B. kollegiale Hospitationen/Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen und Schülerfeedback von Lehrkräften und Schulleitungen übereinstimmend als nützlich angesehen (und dementsprechend genutzt), wohingegen Schulleistungsvergleiche, Lernstandserhebungen und Befunde aus Schulinspektionen deutlich kritischer gesehen werden. Das Verhältnis von Mehraufwand an Arbeit und erwartetem praktischen Nutzen ist von Bedeutung dafür, ob evidenzbasierte Wissensbestände von den Akteuren herangezogen werden.
Wenngleich die Untersuchung einen wichtigen Überblick in vergleichender Perspektive über die Nutzung von verschiedenen Wissensbeständen für die Unterrichts- und Schulentwicklung darstellt und darüber hinaus durch das triangulative Design auch Gründe für das jeweilige Datennutzungsausmaß exploriert, gibt es methodische Einschränkungen, etwa durch die große Heterogenität der Evidenzquellen, welche die Vergleichbarkeit einschränkt, die fehlenden genauen Angaben zur Streuung der ermittelten Werte sowie die fehlenden Aussagen zur Güte (etwa zur Auswertung der qualitativen Daten). Schließlich begrenzt die geringe Zahl der Interviews zu Gründen der Nutzung oder Nicht-Nutzung von Wissensbeständen die Aussagekraft auf die untersuchten Fälle.
Die Steuerungsimplikationen, welche sich aus den so ermittelten Befunden für die Praxis ergeben, erscheinen angesichts des im quantitativen Teil der Untersuchung aufgezeigten ernüchternden Ergebnisses einer eher eingeschränkten Nutzung von Evidenzquellen von grundsätzlichem Wert.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte:
- Welche Wissensbestände für die Fortentwicklung von Unterricht und Schule sind mir bekannt?
- Welche davon halte ich im Hinblick auf zukünftige Entwicklungsprozesse für überdurchschnittlich geeignet? Aus welchem Grund?
- In welchem Ausmaß nutze ich sie?
- Bin ich bereit, aus Wissensbeständen - wie z.B. Lernstandserhebungen - Konsequenzen für die Gestaltung meines Unterrichts abzuleiten?
- Sehe ich in Wissensbeständen wie den Befunden von Schulinspektionen und Vergleichsarbeiten eher externe Kontrollinstrumente oder Potenziale für eine positive Entwicklung meiner Arbeit?
- Inwiefern nutzen meine Kolleginnen und Kollegen Datenquellen für die Unterrichtsentwicklung?
Reflexionsfragen für Schulleitungen:
- Inwiefern ist im Kollegium bekannt, welche Wissensbestände für Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung stehen?
- Welche Einstellungen zur Nutzung dieser Wissensbestände habe ich selbst?
- Welche Evidenzquellen nutze ich bereits, bei welchen ist in Zukunft eine stärkere Nutzung sinnvoll?
- Für die Entwicklung welchen Aspektes meines Unterrichts eignen sich die jeweiligen Wissensbestände?
- Worin sehe ich besondere Potenziale (oder aber Probleme) bei der Nutzung der unterschiedlichen Evidenzquellen?
- Fördere ich das Verhalten innerhalb des Kollegiums, geeignete Wissensbestände für die Entwicklung von Schule und Unterricht zu nutzen?
Um die Rationalität und Effektivität bei der Weiterentwicklung von Schulen und der Ausgestaltung schulischen Handelns zu steigern, wird evidenzbasierter Schulentwicklungsarbeit hoher Stellenwert beigemessen: Beispiele hierfür sind etwa die von der Kultusministerkonferenz nach dem nicht zufriedenstellenden Ergebnis der PISA 2000-Studie implementierten Evaluationsverfahren, aus denen Erkenntnisse für die weitere schulische Entwicklung gewonnen werden sollen – die Autorin spricht hier von einem “Steuerungsparadigma der Evidenzbasierung“ (S. 101). Darüber hinaus steht den schulischen Akteuren eine Vielzahl weiterer Informationsquellen zur Verfügung, die sie für die Fortentwicklung der eigenen Arbeit nutzen können, etwa Ergebnisse der Bildungsforschung, Schülerfeedback, Daten des Bildungsmonitorings, Befunde aus internen Erhebungen oder Fremdevaluationen usw.
Jedoch bindet eine verstärkte Evidenzorientierung in erheblichem Umfang Ressourcen, sodass ihre Wirksamkeit nachzuweisen ist. Ob und wie bereitgestellte Informationen für die Schulpraxis nutzbar gemacht werden, ist somit eine wichtige Frage, zu der im deutschsprachigen Raum der Autorin zufolge bislang allerdings nur wenige Erkenntnisse vorliegen. Das gilt in besonderem Maße im Hinblick auf eine vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Evidenzquellen der so genannten Neuen Steuerung (z.B. Vergleichsarbeiten, Schulinspektionen). Aus diesem Desiderat leitet die Autorin ihre Forschungsfragen ab:
- Inwiefern und in welchem Ausmaß werden verschiedene Datenquellen in der Schulpraxis tatsächlich genutzt?
- Welche Gründe sprechen aus Sicht von Schulleitung und Lehrkräften für oder gegen eine Nutzung bestimmter evidenzbasierter Wissensbestände?
Die Autorin problematisiert, dass es trotz der Bedeutung, die „Evidenz“ zugemessen wird, keine allgemein anerkannte Definition und Konzeptualisierung dieses Begriffes gibt. Dieses Problem bestehe auch für die englischsprachige Literatur. Die Autorin fasst Evidenzen in einem weiten Verständnis als „systematisch generierte, verobjektivierte und explizierte Informations- und Wissensbestände zur Wirksamkeit von Bildungsprozessen und ihren spezifischen Rahmenbedingungen“ auf. Sie rekurriert zudem auf den Forschungsstand, wonach die bisherige Forschung bereits Einflussgrößen auf die Nutzung von Wissensbeständen benenne: So sind von Seiten des Datenangebots etwa leichte Verfügbarkeit der Informationen, hohe Datenqualität und Zeitlichkeit der Rückmeldung die Nutzung begünstigende Einflussgrößen. Auf der Schulebene spielen z.B. Schulkultur und die offene Einstellung der Schulleitung gegenüber einer evidenzbasierten Schulentwicklung eine Rolle. Auf der Seite der individuellen Datenempfänger sind unter anderem Offenheit in Bezug auf Evaluationen und Kompetenzen bei der Auswertung der vorliegenden Daten von Bedeutung.
Angesichts der uneinheitlichen Begrifflichkeiten in der Forschungsliteratur berücksichtigt die Autorin eine weit gefasste Auswahl von potenziellen Evidenzquellen. So gingen dreizehn evidenzbasierte Informationsquellen in ihre Untersuchung ein: 1. Schulleistungsvergleiche (PISA etc.), 2. landesweite Vergleichsarbeiten, 3. Schulinspektionen, 4. schulbezogene Parallelarbeiten, 5. Tests innerhalb des Unterrichts, 6. durch die Schule durchgeführte Befragungen, 7. gemeinsame Unterrichtsentwicklung (kollegiale Hospitation usw.), 8. Schülerfeedback, 9. fachbezogene Zeitschriften, 10. fachübergreifende Zeitschriften, 11. der Bildungsteil von Zeitungen/Zeitschriften, 12. Befunde der Schulstatistik, 13. zentrale Aufgabensammlungen (z.B. durch das IQB).
Die Untersuchung selbst beruht auf der Kombination einer standardisierten Fragebogenstudie mit einer vertiefenden qualitativen Interviewerhebung. Sie wurde im Bundesland Rheinland-Pfalz durchgeführt und berücksichtigte sechs Schulformen (Grundschule, Förderschule, Realschule plus, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule, Berufsbildende Schule).
An der Fragebogenerhebung nahmen 1.230 Lehrkräfte sowie 297 (stellvertretende) Schulleitungsmitglieder teil. Es wurde erfasst, welche Evidenzquellen von Lehrkräften und Schulleitungen als nützlich angesehen wurden und ob bzw. in welchem Ausmaß diese tatsächlich genutzt wurden. Dabei kam eine fünfstufige Antwortskala (von „gar nicht nützlich“ bis „sehr nützlich“ bzw. „gar nicht genutzt“ bis „sehr intensiv genutzt“) zum Einsatz. Aus den so ermittelten Angaben errechnete die Autorin Mittelwerte, die sie – angesichts hoher (aber in der Arbeit nicht konkret angegebener) Standardabweichungen – ohne Fehlerbalken präsentiert. Die Mittelwerte werden getrennt für Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder dokumentiert.
Die Fragebogenerhebung wurde ergänzt durch 35 Interviews an 7 Schulen, wodurch erfasst werden sollte, was die Nutzung evidenzbasierter Informationsquellen förderte oder einschränkte. Die Fallauswahl erfolgte kontrastiv, unterschieden nach Schulformen und dem über die quantitative Erhebung ermittelten Ausmaß der Evidenznutzung. Jeweils ein Schulleitungsmitglied und vier Lehrkräfte je Schule wurden befragt. Die Auswahl der Schulen, an denen die Interviews geführt wurden, richtete sich danach, ob diese im Rahmen der Fragebogenerhebung eine besonders hohe oder eine auffällig geringe Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände erkennen ließen. Ersteres galt für zwei Gymnasien und zwei berufsbildende Schulen, letzteres nur für ein Gymnasium und zwei berufsbildende Schulen, da von Seiten der Gymnasien mit schwacher Evidenzbasierung nur eine geringe Interviewbereitschaft bestand. Die Unterscheidung zwischen Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern wird allerdings bei der Darlegung der Ergebnisse der Interviews zu den Gründen für eine starke oder schwache Nutzung von Wissensbeständen nicht mehr konsequent verfolgt. Für die Ergebnisdarstellung fokussiert die Autorin im Artikel auf die Ergebnisse aus den Interviews.
In methodischer Hinsicht sind dem Artikel lediglich Informationen zu entnehmen, dass die Interviewdaten transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Inwiefern hier Induktion oder Deduktion für das Kategoriensystem leitend waren und inwieweit die Untersuchung Gütekriterien entspricht, ist nicht dokumentiert.
1. Nützlichkeit evidenzbasierter Wissensbestände:
Mitglieder der Schulleitung schätzen v.a. kollegiale Hospitationen/Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen, Schülerfeedback, innerhalb des Unterrichts eingesetzte Tests und Parallelarbeiten als nützlich ein, Lehrkräfte bewerten kollegiale Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen und Schülerfeedback ebenfalls hoch. Einig sind sich beide Gruppen hinsichtlich eines geringen Nutzens von der Berichterstattung zu Schulleistungsvergleichen, Auswertungen der Schulstatistik und Lernstandserhebungen. Beide Gruppen sind sich ebenfalls einig in Bezug auf eine geringe Nutzenzuschreibung von Schulinspektionen, wobei diese von den Lehrkräften deutlich kritischer gesehen werden als von den Schulleitungen. Letztere haben auch eine höhere Meinung von Zeitschriften ohne Schulfachbezug als die Lehrkräfte. In der Regel werden evidenzbasierte Wissensbestände von Schulleiterinnen und Schulleitern als etwas nützlicher bewertet als von den Lehrkräften (lediglich der Bildungsteil von Zeitungen/Zeitschriften macht hierbei eine Ausnahme).
2. Tatsächliche Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände:
Schulleitungen und Lehrkräfte nutzen vergleichsweise intensiv Schülerfeedback und kollegiale Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen. Lehrkräfte setzen darüber hinaus auf den Einsatz von Zeitschriften (aber im Gegensatz zur Schulleitung nur, wenn ein konkreter Fachbezug besteht). Wenig intensiv nutzen Lehrkräfte die Schulstatistik, Befunde der Schulinspektion, Aufgabensammlungen von zentraler Stelle, Befragungen und Ergebnisse landesweiter Lernstandserhebungen und Schulvergleiche. Schulleitungen nutzen am wenigsten intensiv Aufgabensammlungen von zentraler Stelle. Ergebnisse aus Vergleichsarbeiten und Schulleistungsvergleiche werden – auf jeweils geringem Niveau – von Schulleitungen intensiver genutzt als von Lehrkräften. Der größte Unterschied zwischen Schulleitungen und Lehrkräften zeigt sich bei der Nutzung von Befunden der Schulinspektion, die bei den Lehrkräften im Gegensatz zur Schulleitung nur eine sehr geringe Rolle spielt.
3. Gründe für und gegen die Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände:
Problematisch im Hinblick auf die Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände erweist sich aus Sicht der Befragten, dass viele Akteure damit einen deutlichen Mehraufwand an Arbeit bei gering eingeschätztem Nutzen verbinden. Dies gilt v.a. für Schulinspektionen und Vergleichsarbeiten. Kritisiert wird auch der zu große Zeitabstand von Datenerhebung und Rückmeldung, die zudem häufig wenig konkret ausfällt und damit schwierig in schulisches Handeln zu übersetzen sei. Bei Lernstandserhebungen ist den Befragten unklar, ob die Schüler diese ernst genug nehmen, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Die Autorin beobachtet an weniger evidenzbasiert arbeitenden Schulen zudem die Tendenz, schlechte Ergebnisse bei Leistungstests external zu deuten, indem sie einer generellen Leistungsschwäche der Lerngruppe zugeschrieben werden und damit nicht der Fortentwicklung des eigenen Unterrichts nutzbar gemacht werden. Schulinspektionen wiederum werden aufgrund einer punkthaften, dem schulischen Einzelfall zu wenig gerecht werdenden Datenerfassung (anstatt einer längerfristigen Begleitung schulischer Prozesse) kritisch gesehen. Zudem werden Schulinspektionen – offenbar v.a. an wenig evidenzbasierten Schulen – eher als Instrument einer externen Kontrolle denn als Unterstützung bei der schulischen Weiterentwicklung gesehen.
Eine verstärkte Nutzung evidenzbasierter Wissensbestände erfolgt hingegen, wenn diese eine Arbeitserleichterung erlaubt: etwa wenn schulbezogene Zeitschriften Material für den Unterricht bereitstellen. Auch wenn eine persönliche Weiterentwicklung durch „Blick von außen“ – etwa im Rahmen kollegialer Hospitation und z.T. auch der Schulinspektion – zu erwarten ist, werden diese Möglichkeiten genutzt. Vorwiegend an Schulen mit starker Evidenzbasierung der Schul- und Unterrichtsentwicklung sind zudem die Schulleitungen daran interessiert, gute Resultate bei zentralen Prüfungen (bei Berufsschulen auch der IHK- oder HK-Prüfungen) und Schulinspektionen als Mittel der Demonstration von Schulqualität gegenüber Anspruchsgruppen zu verwenden.
Die Autorin sieht hinsichtlich ihrer Daten mögliche Probleme darin, dass vermutlich aufgrund des Untersuchungsdesigns vorwiegend Personen befragt wurden, die einer Datengenerierung und –nutzung ohnehin eher aufgeschlossen gegenüberstehen. Auch sei die Gefahr eines sozial erwünschten Antwortverhaltens oder einer Falscheinschätzung des Ausmaßes der eigenen Nutzung von Evidenzquellen nicht auszuschließen. Sie schlägt deshalb für die Zukunft stärker beobachtende Studien vor – allerdings ohne diesen Gedanken zu konkretisieren oder die ebenfalls vorhandenen Limitationen derartiger Studien zu erwähnen.
Die Autorin problematisiert den unterschiedlichen möglichen Umgang mit Evidenzquellen, der keineswegs immer zu einer schulischen Entwicklung führt: so könne eine Lehrkraft die Befunde der Lernstandserhebungen lediglich als Ausweis der Leistungsstärke der Schülerinnen und Schüler ansehen (und weniger gute Ergebnisse auf deren vermutete „Unfähigkeit“ zurückführen) oder sie könne die gleichen Befunde zur Entwicklung des eigenen Unterrichts verwenden. Auch Schulinspektionen können entweder als unliebsame Kontrollinstrumente einer vorgesetzten Behörde oder als willkommene Datenlieferanten für die Weiterentwicklung der schulischen Praxis bewertet werden. Eine Lösungsmöglichkeit für diesen Punkt könne der Autorin zufolge darin bestehen, die Akzeptanz von externer Evaluation durch Stärkung der internen Evaluation und die Vermittlung von Güte sozialwissenschaftlicher Forschung zu verstärken. Hier sieht sie allerdings noch Untersuchungsbedarf. Angesichts der Abschaffung der Schulinspektion in Rheinland-Pfalz durch die Landesregierung im Jahre 2016 weist die Autorin zudem auf das Problem der Verlässlichkeit und Planbarkeit von Evidenzquellen für Schulentwicklungsarbeit hin.
Befunde der empirischen Bildungsforschung sind nach Aussage der Autorin auch häufig nicht für die Praxis sinnvoll aufbereitet. Vor diesem Hintergrund mahnt sie eine engere Verknüpfung evidenzbasierter Wissensbestände mit den jeweiligen Fachdidaktiken und die stärkere Vermittlung des Themas „evidenzbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung“ im Rahmen der Lehramtsausbildung an.
Abschließend erwähnt die Autorin hinsichtlich des Einsatzes von Evidenzquellen noch Möglichkeiten der Entlastung von Schulleitungen und Lehrkräften und einer Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützungsmaßnahmen durch pädagogische Landesinstitute, allerdings ohne dies näher zu erläutern.
Ohne Zweifel ist angesichts der aktuellen Tendenz, die evidenzgestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung zu stärken, die der Untersuchung zugrundeliegende Fragestellung von sehr hoher Relevanz. Dies gilt umso mehr, als dass diese durch den vergleichenden Ansatz und die Ursachenforschung im Rahmen der qualitativen Interviews über die bisherigen Arbeiten zu diesem Thema hinausgeht. Hier liegt ein zentraler Mehrwert der Studie, die zudem auch durch ihr triangulatives Vorgehen plausibel angelegt erscheint. Dennoch ist die Untersuchung nicht ausschließlich positiv zu bewerten, da sie neben einer sinnvollen Fragestellung und unabweisbar wichtigen Detailergebnissen auch eine Reihe von Schwächen aufweist:
Es beginnt mit dem missverständlichen Untertitel der Arbeit: Wird wirklich ein Paradigma überprüft oder nicht vielmehr der alltägliche Umgang schulischer Akteure mit einem Paradigma? Hier liegt eine grundsätzliche Unklarheit in der Semantik des Paradigma-Begriffs. Auch stellt die Auswahl potenzieller Evidenzquellen eher ein uneinheitliches Sammelsurium dar, was von der Autorin mit einem „weiten“ Verständnis begründet wird: vom Ergebnis einer Vergleichsarbeit über das Schülerfeedback bis hin zu fachbezogenen Zeitschriften. Hier wäre eine stärkere Strukturierung (etwa nach Art der Evidenzquelle oder bezogen auf ihr Einsatzpotenzial bei den unterschiedlichen Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung) sinnvoller gewesen.
Darüber hinaus stellen sich z.B. Fragen nach der unterschiedlichen Objektivität bzw. Standardisierung der Instrumente. So bestehen diesbezüglich starke Unterschiede zwischen Schülerfeedback und Vergleichsarbeiten. Zudem ist das Schülerfeedback nicht zwingend systematisch erhoben worden und passt damit eigentlich nicht in allen Fällen in die von der Autorin selbst gegebene Evidenzdefinition. Auch inhaltliche Unterschiede der Evidenzquellen sind deutlich erkennbar: Eine Vergleichsarbeit vermittelt immer einen Eindruck von der Leistungsstärke und dient diagnostischen Zwecken, wozu jedoch etwa fachbezogene Zeitschriften weniger bzw. nichts beitragen können. Fachbezogene Zeitschriften wiederum können umfangreiches inhaltliches Material für die Unterrichtsentwicklung liefern, was Vergleichsarbeiten nicht können. Die Evidenzquellen zielen deshalb auf vollkommen unterschiedliche Aspekte der Unterrichts- und Schulentwicklung: Inwiefern bei einer Untersuchung eine stärker hinsichtlich der unterschiedlichen Felder von Schul- und Unterrichtsentwicklung systematisierte Betrachtung sinnvoll wäre, wird nicht diskutiert. Auch scheint die Aufstellung der Evidenzquellen keineswegs vollständig. So scheinen neben fachbezogene Zeitschriften auch (Fach-) Bücher und Internetressourcen (wie z.B. Bildungsserver) relevante Quellen zu sein.
Als gelungen ist zu bewerten, dass bei der Untersuchung zwischen der Einschätzung von Nützlichkeit und der tatsächlichen Nutzung von Evidenzquellen unterschieden wurde, da hierdurch ein erster Hinweis auf Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen hinsichtlich der Bewertung und Nutzung von Evidenzquellen erzielt wird – auch wenn diesem Punkt durch die Autorin nur ansatzweise nachgegangen wird. Auch die Trennung von Lehrkraft- und Schulleitungsperspektive ist aufgrund der für diese Gruppen mutmaßlich unterschiedlich großen Bedeutung der Entwicklung konkreter Unterrichtssequenzen einerseits oder fachübergreifender schulischer Prozesse andererseits sinnvoll.
Bei der Darlegung der Ergebnisse aus der quantitativen Befragung wäre es hilfreich gewesen, zumindest Standardabweichungen zu den Mittelwerten anzugeben, um dem Leser wenigstens einen groben Hinweis auf die Streubreite der Werte zu geben. Auch ist bei der bloßen Angabe von Mittelwerten nicht auszuschließen, dass diese – etwa im Falle einer ausgesprochen bimodalen Verteilung, aber auch im Falle einer extremen Streuung – in einem Bereich liegen, der für die Ergebnisdiskussion wenig aussagekräftig ist.
Als außerordentlich positiver Aspekt der Untersuchung erweisen sich die Interviews, da hierbei die konkreten Gründe, warum Evidenzquellen genutzt oder ignoriert werden, zum Thema gemacht werden. So gelingt es, Aspekte zu identifizieren, welche die Nutzung bestimmter Evidenzquellen behindern, aber auch Potenziale für eine Verstärkung ihrer Nutzung aufzuzeigen. Auf der Basis dieser Interviewergebnisse könnten daher eventuell die Ursachen für eine bisher zu geringe Nutzung von Evidenzquellen in den Blick genommen werden, was das Ziel einer Stärkung der evidenzbasierten Unterrichts- und Schulentwicklung stützen würde. Nichtsdestotrotz kann es sich bei der vorliegenden Arbeit nur um eine erste Annäherung an das Problem handeln: Die geringe Zahl der Interviews etwa lässt keine Aussage dazu zu, ob die festgestellten Probleme und Potenziale nur in Einzelfällen bestehen oder aber repräsentativ sind. Dies müsste aber geklärt werden, wenn es zukünftig darum gehen soll, sinnvolle Strategien zu entwickeln, mit denen die Evidenzbasierung schulischer Arbeit gestärkt werden kann. Auch beziehen sich die zitierten Aussagen nur auf einen Teil der Evidenzquellen (vornehmlich Vergleichsarbeiten und Schulinspektionen), andere werden kaum oder gar nicht einbezogen.
Methodisch enttäuscht an dieser Stelle schließlich, dass unklar ist, nach welchen Kategorien kodiert wurde und auch die Güte der Untersuchung nicht dargelegt wurde.
Somit stellt sich die Arbeit – bei den genannten Defiziten – möglicherweise als anregender „Türöffner“ für vertiefende Untersuchungen heraus, in denen Problemen und Potenzialen der Nutzung von Evidenzquellen bei der Unterrichts- und Schulentwicklung im Detail nachzugehen wäre, um Strategien dafür zu entwickeln, dass diese Evidenzquellen verstärkt zur Gestaltung schulischer Entwicklungen herangezogen werden. Dabei dürfte es auch spannend sein, empirisch vertieft zu eruieren, wie die verschiedensten Evidenzquellen in ihrer Nutzung ggfs. aufeinander bezogen werden (können).
Institut für Bildungsanalysen (IBBW)
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Schulentwicklung NRW
Sie haben Fragen oder Anregungen?