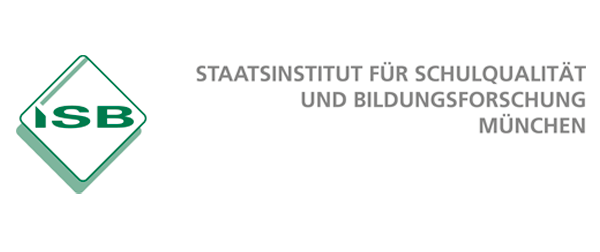Fragestellungen der Studie:
- Wie unterstützen Lehrkräfte im offenen Unterricht bzw. in selbstgesteuerten Unterrichtssituationen?
Rezension zur Studie
Siemon, J., Scholkmann, A. & Paulsen, T. (2018). Beschreibung von Formen lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens im offenen Unterricht. Eine Analyse anhand von Videodaten. Zeitschrift für Bildungsforschung, 8(1), 19–41.FIS BildungAktive und selbstgesteuerte Lernphasen in offenen Unterrichtssettings werden für die Gestaltung von Unterricht sowohl pädagogisch-didaktisch als auch bildungspolitisch begründet befürwortet. Damit verbundene Veränderungen der Lehrerrolle werden seit einiger Zeit diskutiert und erforscht.
Lange mangelte es jedoch an standardisierten Beobachtungstools, die das lehrerseitige Unterstützungsverhalten in offenen und selbstgesteuerten Unterrichtssituationen vollständig und intersubjektiv zu erfassen vermögen. Vor diesem Hintergrund unterbreiten Siemon, Scholkmann und Paulsen einen Vorschlag für ein niedrig-inferentes Beobachtungstool, welches in einem mehrschrittigen Prozess entwickelt und auf seine Zuverlässigkeit methodisch abgesichert wurde.
Sie identifizieren 6 Kategorien des lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens:
- Erklärung didaktischer Entscheidungen
- Steuerung der Lernhandlungen der Schülerinnen und Schüler
- Inhaltliche Hinweise, Anleitungen und Erklärungen
- Explizite Bestärkung
- Diagnose
- Gemeinsamer kooperativer Dialog auf Augenhöhe
Das entwickelte Beobachtungstool erlaubt die Beschreibung von schulform- sowie fach- und fachrichtungsübergreifendem lehrerseitigen Unterstützungsverhalten in offenen Unterrichtsformen.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Wie sollte meiner Meinung nach lehrerseitiges Unterstützungsverhalten in offenen Unterrichtssituationen gestaltet sein?
- Inwiefern lässt sich mein eigenes Unterstützungsverhalten den beschriebenen Kategorien zuordnen?
- Woran erkenne ich in offenen Unterrichtssituationen, ob meine Schülerinnen und Schüler Unterstützungsbedarf haben? Welche Regeln ließen sich mit ihnen in diesem Zusammenhang ggf. erarbeiten?
- Inwiefern nutze ich positives Feedback (Lob, Bestärkung, aktives Zuhören, etc.) als Unterstützungsmaßnahme im offenen Unterricht?
- Welche Maßnahmen ergreife ich, um mein Unterstützungsverhalten graduell, d. h. schrittweise, abnehmend zu gestalten?
- Wie gestalte ich die Überprüfung des Lernerfolgs meiner Schülerinnen und Schüler im offenen Unterricht?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Inwiefern ermögliche ich meinem Kollegium den Austausch über die Gestaltung von offenen Lernumgebungen und der damit verbundenen Materialentwicklung zu bestimmten Zeitpunkten des Schuljahres?
- Welche Strategien wenden meine Kolleginnen und Kollegen an, um den Lernstand vor, während und nach offenen Lernphasen zu diagnostizieren? Inwiefern könnte ich sie dahingehend in ihrer Professionalisierung unterstützen?
- Welche Maßnahmen ergreife ich selbst, um meinem Kollegium oder einzelnen Lehrkräften positives Feedback (Lob, Bestärkung, aktives Zuhören etc.) zu geben und sie in ihrer Professionsentwicklung zu unterstützen?
- Welche Barrieren müssen ggf. an meiner Schule überwunden werden, um offenen Unterricht so zu gestalten, dass sowohl leistungsschwache als auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden? Welche besonderen Maßnahmen wären in dem Zusammenhang vor allem für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler zu ergreifen?
Siemon et al. stellen zunächst die Erfassung von lehrerseitigem Unterstützungsverhalten in offenen Unterrichtssituationen als Herausforderung für die bildungswissenschaftliche Forschung heraus. Offener Unterricht sei pädagogisch-didaktisch und bildungspolitisch gewünscht. Dementsprechend werde das Verhalten der Lehrkräfte in solchen Settings verstärkt erforscht. Dies geschehe insbesondere im Bereich der Lernmotivationsforschung. Dabei würden häufig relativ allgemein gehaltene Befragungen von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Beobachtungsstudien stammten primär aus der Scaffolding-Forschung. In dieser ist aber nach Aussage des Autorenteams der Geltungsbereich der Studien oft eingeschränkt, bislang wurden nicht alle möglichen Verhaltensphänomene im Kontext der lehrerseitigen Unterstützungsformen dokumentiert und viele Befunde seien zudem interpretativ, also nicht gegen Wahrnehmungsverzerrungen abgesichert.
Da Lehrpersonen in offenen Unterrichtssituationen eine tragende Rolle bei der individuellen Unterstützung von Lernenden hätten, sei die Analyse ihres Verhaltens sowie dessen Wirkung durch die Erfassung reliabler und valider Daten von Bedeutung. Zudem könnten solche Daten auch für die Unterrichtsreflexion in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften eingesetzt werden. Hier böte sich insbesondere die Videoanalyse an, mit welcher durch die Trennung von Datenerhebung und -analyse die Möglichkeit bestehe, auch sonst nur schwer zugängliche Details im Unterrichtsgeschehen zu analysieren. Demnach ist das Ziel des Beitrags von Siemon et al., ein derartiges Beobachtungsinstrument für Analysen in der beruflichen Bildung zu entwickeln, in welcher zum offenen Unterricht und dem darin vorkommenden Unterstützungsverhalten der Lehrpersonen bislang wenig Evidenz vorliegt.
Im Anschluss gehen Siemon et al. auf den Stand der Forschung ein. Zunächst verweisen sie auf die Bedeutsamkeit von lehrerseitigem Unterstützungsverhalten, indem sie auf Befunde zum Einfluss von Lehrerverhalten auf die Lernmotivation und Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern verweisen. Zudem fänden sich lernförderliche Effekte bei Autonomiegewährung in offenen Lernarrangements. Jedoch fehle es bislang an Instrumenten, mit denen über Selbstauskünfte hinausgehend das Unterstützungsverhalten von Lehrkräften untersucht werden könnte.
Auch im Kontext der Scaffolding-Forschung, welche zeige, dass angepasste Unterstützung ein zentraler Erfolgsfaktor für das Lernen ist, findet sich aus Sicht des Autorenteams eine Engführung durch die ausschließliche Betrachtung der kognitiven Regulationsebene des lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens. Siemon et al. stellen heraus, dass die individuelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in offenen Unterrichtssettings nicht nur kognitiv, sondern auch metakognitiv und emotional erfolgt und vor dem Hintergrund bisheriger Analysen einer weiteren Aufschlüsselung bedarf.
Danach werden durch das Autorenteam bisherige Systematiken aus verschiedenen Arbeitskontexten zur Beobachtung lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens skizziert. Sie benennen die jeweiligen Formen sowie weitere unterstützende Maßnahmen, die jeweiligen Interpretationsgrundlagen und den jeweiligen Geltungsbereich als relevante Ausgangspunkte für die eigene Vorgehensweise.
Vor dem skizzierten Hintergrund ergibt sich die folgende Fragestellung:
Welche Formen individueller lehrerseitiger Unterstützung lassen sich in offenen Unterrichtssituationen identifizieren?
Stichprobe und Datengewinnung
Zur Beantwortung der o. g. Fragestellung wurden sukzessive Video- und Audioaufnahmen von offenem Unterricht (21 Unterrichtsdoppelstunden) an beruflichen Schulen gemacht (Berufsschule, Berufsfachschule und berufliches Gymnasium). Die Erhebung erfolgte mittels eines multimodalen Verfahrens mit mehreren Standkameras, Kameraperspektiven und synchronisierten Tonaufnahmen aller Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.
Methodisches Vorgehen
Basierend auf diesem Datenmaterial wurden induktiv-inhaltsanalytisch (siehe z. B. Mayring, 2010) zunächst sechs Kategorien zur Beschreibung des Unterstützungsverhaltens der Lehrkräfte hergeleitet. In einem zweiten Schritt wurde ein formalisiertes Verfahren zur Anwendung der Kategorien entwickelt. Hierzu bedienten sich Siemon et al. der Methode des „event samplings“. Ein Event (ein Gesamtereignis) lag vor, wenn die Initiierung eines Gesprächs zwischen einer Lehrperson und einzelnen oder einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern innerhalb einer in sich abgeschlossenen Interaktion erfolgte.
Zusätzlich wurden innerhalb der einzelnen Gesamtereignisse sog. Mikro-Events identifiziert, die jeweils eine erkennbar eigenständige kommunikative Einheit mit semantisch kohärentem Inhalt darstellten. In einem letzten Schritt wurde die Zuverlässigkeit des derart gewonnenen Beobachtungstools in Form der Interrater-Reliabilität durch die Bestimmung von Cohen's Kappa- und Holsti-Koeffizienten geprüft. Der Reliabilitätskoeffizient nach Holsti lag bei 0.83 und kann als gut bewertet werden.
Als Ergebnis der Analysen identifizieren Siemon et al. sechs Kategorien für die individuelle lehrerseitige Unterstützung in offenen Unterrichtssituationen mit hinreichenden Interrater-Reliabilitäten:
- Erklärung didaktischer Entscheidungen: Die Lehrperson erläutert oder begründet eine didaktische Entscheidung, eine Aufgabenstellung oder Anweisung und klärt darüber die „Warum“-Frage.
- Steuerung der Lernhandlungen der Schülerinnen und Schüler: Die Lehrperson gibt direkte oder indirekte Handlungsanweisungen mit organisatorischer Ausrichtung.
- Inhaltliche Hinweise, Anleitungen und Erklärungen: Sämtliche Unterstützungshandlungen, die einen Inhaltsbezug aufweisen und helfen, den bearbeiteten Sachverhalt zu klären.
- Explizite Bestärkung: Die Lehrperson gibt positives Feedback, lobt, bestärkt und hört aktiv zu.
- Diagnose: Die Lehrperson wendet verschiedene Strategien an, um festzustellen, an welcher Stelle im Lernprozess sich die Schülerinnen und Schüler befinden.
- Gemeinsamer kooperativer Dialog auf Augenhöhe: Die Lehrperson hat keinen offensichtlichen Wissensvorsprung und begibt sich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam in einen Problemlöseprozess.
Zum Hintergrund
Die Entwicklung und methodische Prüfung eines standardisierten Beobachtungstools von Siemon et al. greift vor dem Hintergrund der Diskussion des lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens in offenen Unterrichtssettings ein für die Administration und für die Schule relevantes Forschungsdesiderat auf.
Die Relevanz ihres Vorhabens ergibt sich aus pädagogisch-didaktischen sowie bildungspolitischen Diskursen zur Rolle von Lehrpersonen im offenen Unterricht und damit verbundenen Forschungsbefunden. Zunächst werden die veränderte Rolle von Lehrpersonen in offenen Unterrichtsformen, damit verbundene Forschungsbefunde und Erhebungsverfahren sowie damit verbundene Einschränkungen skizziert. Aus dem Forschungsstand wird deutlich, dass eine konzeptionelle Erweiterung der Betrachtung des lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens erforderlich ist. Diesem Desiderat nimmt sich das Autorenteam an. Die Argumentationsweise und Hinführung zum eigenen Vorhaben gelingen.
Zum Design
Das methodische Vorgehen bezieht sich auf die Entwicklung des Kategoriensystems, die Kodierung des Materials und die Qualitätsprüfung. Diese Angaben werden ausführlich und nachvollziehbar benannt.
Zu den Ergebnissen
Die Zielstellung der Untersuchung wird erreicht. Es liegt eine sorgfältige Dokumentation von sechs Kategorien zur Beschreibung lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens in offenen Unterrichtssituationen vor. Dabei werden Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten zu bestehenden Systematiken herausgearbeitet. Die vorgenommenen Schlussfolgerungen erscheinen plausibel: Einerseits wird der Mehrwert des selbstentwickelten Instrumentariums herausgestellt (Nachweis zufriedenstellender Intersubjektivität durch die Reliabilitätswerte, Anwendungsmöglichkeit an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Nutzung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften). Andererseits wird eingestanden, dass mit dem vorgelegten Instrumentarium lediglich eine Beschreibung von Verhaltensphänomenen zur Diskussion gestellt wird, zu der noch eigene Wirkaussagen getätigt werden können. In diesem Kontext werden im Rekurs auf ähnliche Konstrukte weiterführende Annahmen zu möglichen Effekten getätigt, vor allem zur Kontingenz als wichtigem Erfolgsfaktor.
Fraglich bleibt, warum das Autorenteam bei der Entwicklung lediglich induktiv vorgegangen ist und nicht bereits an dieser Stelle bestehendes Wissen aus den anderen Systematiken eingeflochten hat. Es wird sich in der Zukunft zeigen müssen, wie die Nutzung dieses Instruments einen Mehrwert für die skizzierten Handlungsfelder bieten wird.
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Sie haben Fragen oder Anregungen?
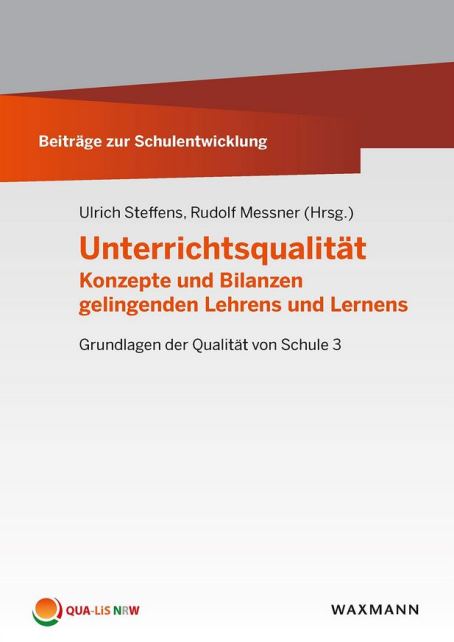 Unterrichtsqualität
Unterrichtsqualität