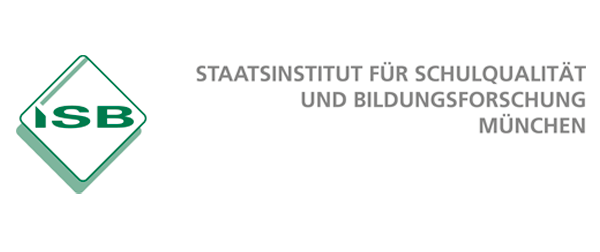Fragestellungen der Studie:
- Elterliches Vertrauen gegenüber Schulen - welche unterschiedlichen Typen gibt es?
Rezension zur Studie
Bormann, I. & Adamczyk, J. (2016). Typen elterlichen Vertrauens gegenüber Schulen: Eine Fallstudie zu schulbezogenen Heuristiken. Zeitschrift für Bildungsforschung, 6, 169–183.FIS BildungStudien zur Eltern-Schule-Beziehung berücksichtigten den Faktor Vertrauen bisher nur unzureichend. Bormann und Adamczyk untersuchen daher elterliches Vertrauen in Schule und in Lehrkräfte vertrauenstheoretisch fundiert in einer explorativen Fallstudie, um folgende Forschungsfragen zu beantworten:
- Wie unterscheiden sich Eltern hinsichtlich ihres schulbezogenen Vertrauens?
- Welche Typen elterlichen Vertrauens lassen sich ermitteln?
Für die Beantwortung der beiden Fragen nutzten die Autorinnen 23 leitfadengestützte Interviews, die sie mit Eltern von 8 bis 12-jährigen Kindern in der Phase der Wahl der weiterführenden Schule geführt hatten. Die Interviews wurden explorativ qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. Für die Typenbildung wählten Bormann und Adamczyk gezielt 8 Interviews aus, die hinsichtlich der Merkmale Bildungsstatus der Eltern und Stärke des Vertrauens maximal kontrastierten.
Auf dieser Basis lassen sich 2 elterliche Vertrauenstypen unterscheiden: Unter den ersten Typ fallen Eltern als reflektiert vertrauende Partner. Diese Eltern verstehen sich bei der Schulwahl für ihr Kind als überlegte Entscheider. Sie erzeugen ihr Vertrauen in Schule kognitiv begründet und greifen hierzu auf ein umfangreiches Informationsreservoire zurück, um sich ein möglichst fundiertes Urteil bezüglich der Schule zu bilden. Dem zweiten Typ gehören Eltern an, die sich als bedürfnisorientiert vertrauende Kunden beschreiben lassen. Diese Eltern sind im Vergleich zu den Eltern des ersten Typs formal niedriger gebildet. Sie generieren Vertrauen primär emotional und projizieren es im Hinblick auf die Interessen ihres Kindes vorrangig auf konkrete Lehrkräfte (Menschen) und nicht auf die Schule (Institution). Um das Vertrauen dieser Eltern zu erwerben, ist kontinuierliche Beziehungsarbeit durch Lehrkräfte erforderlich.
Der Theorieteil des Beitrags liefert eine effektive Einführung in vertrauenstheoretische Grundlagen, insbesondere in die differentielle Vertrauenstheorie und bezieht deren Inhalte aufschlussreich auf die Eltern-Schule-Beziehung. Zwei Kritikpunkte sind gegenüber der explorativen Fallstudie von Bormann und Adamczyk anzumelden: Zunächst ist die empirische Datenmenge mit 8 Fällen, aus denen die beiden Vertrauenstypen abgeleitet werden, gering. Ferner weist die Beschreibung des Designs Lücken auf, sodass die Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens nur eingeschränkt gegeben ist. Beide Forschungsfragen erfahren Beantwortung. Die vorgelegten Befunde, welche durch Anschlussuntersuchungen mit breiterer empirischer Basis bestätigt und vertieft werden müssen, indizieren, dass eine variantenreichere Elternarbeit an weiterführenden Schulen geboten ist.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Wie gehe ich in meiner Elternarbeit vor und was tue ich konkret, um das Vertrauen von Eltern in meine Arbeit und in die der Schule zu steigern?
- Kann ich Eltern meiner Klasse bzw. meiner Lerngruppe den bestimmten Vertrauenstypen zuordnen? Was folgt daraus für meine zukünftige Elternarbeit?
- Wie kann ich das Vertrauen von Eltern in meine Arbeit und das Schulsystem gezielt steigern?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Wie können wir unsere Elternarbeit diversifizieren, um den unterschiedlichen Typen elterlichen Vertrauens besser zu entsprechen?
- Welche Konsequenzen leiten wir aus den nachgewiesenen unterschiedlichen Vertrauenstypen für die Beratung von Eltern beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ab?
- Wie kann ich die Lehrkräfte meiner Schule für unterschiedliche Typen elterlichen Vertrauens sensibilisieren?
Schulische Entwicklungsprozesse werden nicht zuletzt durch das Verhalten von Eltern beeinflusst. So unstrittig dieser Zusammenhang ist, so unerforscht erweist sich der Faktor Vertrauen im Forschungsfeld der Schule-Eltern-Beziehung. Bormann und Adamczyk verstehen ihre explorative Fallstudie als Auftakt, um dieses Desiderat empirisch und theoretisch fundiert aufzuarbeiten.
Das Vertrauen von Eltern in die Arbeit der Schule ist unverzichtbar. Die Schulpflicht zwingt Eltern ihr Kind einer Institution anzuvertrauen, in der professionelle Pädagoginnen und Pädagogen relativ autonom und zudem schwer kontrollierbar agieren. Hinzu kommt, dass kausale Wirkungszuschreibungen im schulischen Lehr-Lern-Prozess in der Regel nicht möglich sind (Rolff, 2012). Diese komplexe Gemengelage geht mit Unsicherheit einher. Diese Unsicherheit, die aus Wissenslücken oder Überkomplexität erwächst, kann durch Vertrauen reduziert, teilweise sogar neutralisiert werden. Vertrauen sorgt dafür, dass Personen letztlich trotz unvollständigen Wissens handlungsfähig bleiben (Luhmann, 2000). Am Beispiel der Wahl einer weiterführenden Schule – ein Umstand, der Eltern vor einen schwierigen Entscheidungsprozess stellt – untersuchen die Autorinnen mittels Sekundäranalysen von Interviews Typen elterlichen Vertrauens.
Die vorliegende Studie basiert dabei auf dem Vertrauensbegriff der differentiellen Vertrauenstheorie von Schweer und Thies (2003). Demnach bauen Menschen Vertrauen auf der Grundlage sozialer Wahrnehmungsprozesse und Informationsverarbeitungsprozeduren auf, wobei institutionelle, situative und personale Faktoren relevant sind:
- Institutionelle Faktoren betreffen Asymmetrien zwischen Interaktionspartnerinnen und -partnern, ungleichen Handlungsoptionen sowie unvollständigem Wissen.
- Situative Faktoren berühren die subjektiv wahrgenommene Qualität der Interaktion beim Anfangskontakt zwischen denen, die Vertrauen geben, und jenen, die Vertrauen nehmen.
- Personale Faktoren umfassen die individuelle Vertrauenstendenz und Erwartungen an Vertrauenswürdigkeitsmerkmale (z. B. wahrgenommene Kompetenz).
Die Autorinnen streben mit ihrer explorativen Fallstudie an, eine Typologie elterlichen Vertrauens gegenüber Schule zu erstellen. Hierzu legen sie ihrer Untersuchung zwei Forschungsfragen zugrunde:
- Wie unterscheiden sich Eltern hinsichtlich ihres schulbezogenen Vertrauens?
- Welche Typen elterlichen Vertrauens lassen sich ermitteln?
Im Zeitraum von August 2012 bis Juli 2013 wurden im Raum Marburg 23 leitfadengestützte Interviews mit Eltern durchgeführt. Alle interviewten Eltern hatten Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, da in diesem Alter in Hessen die Wahl der weiterführenden Schule ansteht. Dieser Wahlprozess ist für Eltern von Unsicherheit geprägt (vgl. situativer Faktor). Er führt zu einer riskanten Entscheidung, da die (vermeintlich) geeignetste weiterführende Schule grundsätzlich auf Basis unvollständigen Wissens auszuwählen ist (vgl. institutioneller Faktor). Den personalen Faktor bildeten die Autorinnen dadurch ab, dass Eltern mit unterschiedlichem formalen Bildungsstatus in das Sample aufgenommen wurden.
Im ersten Teil der leitfadengestützten Interviews wurde in offenen Fragen das narrative Wissen der Eltern (z. B. eigene Schulerfahrungen, aktuell wahrgenommene Schulsituation der Kinder) erhoben, ohne dass explizit auf das Phänomen Vertrauen eingegangen wurde. Im zweiten Interviewteil wurde das semantische Wissen abgefragt. Hierzu sollten die Eltern zum einen spontane Assoziationen zum Begriff Vertrauen nennen. Zum anderen wurden sie angeregt, auf zwei fünf-stufigen Skalen die „Wichtigkeit des Vertrauens“ und die „Stärke des Vertrauens“ bezüglich verschiedener Institutionen, darunter das Bildungssystem und die Schule, zu bestimmen und zu erläutern.
Alle Interviews wurden nach vereinfachten Regeln transkribiert und qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. Orientiert an Kelle und Kluge (2010) nahmen die Autorinnen anschließend eine Fallauswahl vor, gruppierten die Fälle nach festgestellten Regelmäßigkeiten und suchten innerhalb einer Fallcharakteristika nach Zusammenhängen zwischen weiteren Merkmalen.
Die Beantwortung der beiden Forschungsfragen im Rahmen der explorativen Fallstudie beruht auf 8 Einzelinterviews, die aus dem oben benannten Sample an 23 Interviews gezielt entnommen sind (Kriterium: maximal kontrastierende Ausprägung von Bildungsstatus und Stärke des Vertrauens).
Forschungsfrage 1: Wie unterscheiden sich Eltern hinsichtlich ihres schulbezogenen Vertrauens?
Die Autorinnen entwickelten drei unterschiedliche Fallbeschreibungen aus dem analysierten Interviewmaterial:
- Fall A (vier interviewte Eltern) betrifft Personen mit hohem formalem Bildungsabschluss, die der Schule ein hohes Maß an Vertrauen entgegenbringen. Diese Eltern sind gut informiert, engagieren sich für die Schule und richten an die Schule hohe Erwartungen. Ihre Vorstellungen von gutem Unterricht, guter individueller Förderung und guter Betreuung und Fürsorge sind klar. Eltern aus dem Fall A nehmen die Beziehung zur Schule als unfreiwillig, aber wichtig wahr und unterstellen den Akteurinnen und Akteuren in der Schule, dass sie kompetent und verbindlich die Regeln (z. B. SchulG) einhalten. Die Eltern überbrücken ihr Wissensdefizit gegenüber der Institution Schule in der Frage der Schulwahl rational und durch ein besonderes Maß an Eigeninitiative und Verantwortung.
- Fall B (zwei interviewte Eltern) umfasst Eltern mit hoher formaler Bildung, deren Vertrauen in das Bildungssystem gering ausfällt. Dies liegt insbesondere daran, dass sie das Bildungssystem als starr und veraltet empfinden. Diese Eltern engagieren sich partizipativ in Schule und befördern deren weitere Entwicklung im Interesse des eigenen Kindes. Zugleich halten sie ihre Einflussmöglichkeiten für begrenzt, weshalb sie ihrem schulischen Engagement eine negative Kosten-Nutzen-Bilanz zuschreiben. Diesen Eltern ist bei der Schulwahl der auf informellem Weg verbreitete „gute Ruf“ einer Schule wichtig. Die Eltern aus Fall B bringen primär Lehrkräften, welche kompetent für die Kinder sorgen, nicht aber dem Bildungssystem an sich, emotionales Vertrauen entgegen.
- Fall C (zwei interviewte Eltern) involviert Eltern mit niedrigem formalen Bildungsstatus und hohem Vertrauen in das Bildungssystem. Diese engagieren sich in der Unterstützung ihres Kindes. Partizipative Gestaltungsmöglichkeiten hingegen nehmen sie nicht wahr – insbesondere, weil fehlerhafte Annahmen über die Möglichkeiten der Schulmitwirkung bei diesen Eltern vorliegen. Dem Bildungssystem wird ein hohes Vertrauen entgegengebracht, weil dieses wichtig sei und der späteren beruflichen Qualifizierung diene. Lehrkräften bringen Eltern dieses Falls zunächst kein Vertrauen entgegen. Vielmehr müssen sich Lehrkräfte elterliches Vertrauen erarbeiten, was eine intensive und kontinuierliche Elternarbeit voraussetzt. Ein „erarbeitetes“ Vertrauen ist jedoch als hoch und stabil einzuschätzen.
Forschungsfrage 2: Welche Typen elterlichen Vertrauens lassen sich ermitteln?
Nach einem kategorialen Vergleich der Fälle A bis C in den Bereichen Rollenvorstellungen, Vertrauensbegründungen und Vertrauensobjekte können die Autorinnen die Fälle A und B als Varianten eines Typs elterlichen Vertrauens und den Fall C als einen weiteren Vertrauenstyp herausarbeiten.
- Reflektiert vertrauende Partner (Typ I): Die Eltern des Vertrauenstyps I handeln im Interesse ihres Kindes informiert, kompetent, reflektiert und selbstbewusst. Das Bildungssystem erachten sie als notwendiges Übel, das die eigenen Erziehungs- und Bildungsvorstellungen nicht hinreichend abdeckt, weshalb eigeninitiativ diese Lücke minimiert werden muss. Eltern dieses Typs nehmen Lehrkräfte als kompetente Repräsentanten des als problematisch empfundenen Teils des Bildungssystems wahr. Nicht zuletzt zwingt die Schulpflicht die kritisch-reflektierten Eltern dazu, den Lehrkräften ihres Kindes Vertrauen entgegenzubringen – allerdings nur bedingt. Dieser Bedingtheit ihres Vertrauens sind sich die Eltern bewusst.
- Bedürfnisorientiert vertrauende Kunden (Typ II): Die Eltern des Vertrauenstyps II bringen Lehrkräften Vertrauen entgegen, weil sie diese als professionelle und kompetente Entscheidungsträgerinnen und -träger für ihr Kind wahrnehmen. Sie delegieren Entscheidungsaufgaben und Verantwortung für ihr Kind auf die Lehrkräfte – die Schule wird also als eine Art Dienstleister angesehen. Ihr Vertrauen basiert auf nur begrenzten Informationen; Kontakte zur Schule sind selten.
Zum Hintergrund
Obwohl in der US-amerikanischen Vertrauensforschung die Beziehung von Eltern und Schulen seit längerer Zeit untersucht wird, fand der Faktor Vertrauen im Zusammenhang der Eltern-Schul-Beziehung in der deutschsprachigen Bildungsforschung bislang wenig Berücksichtigung. Insofern ist der Einschätzung der Autorinnen zuzustimmen, dass sie mit vorgelegter Studie „[…] einen Beitrag dazu leisten, diese Forschungslücke theoretisch und empirisch fundiert zu schließen“ (Bormann & Adamczyk, 2016, S. 170). Die Autorinnen stellen die vertrauenstheoretischen Grundlagen zum Verständnis der Studie nachvollziehbar dar. Insbesondere die differentielle Vertrauenstheorie wird prägnant referiert. Verweise auf vertiefende Forschungsarbeiten neueren Datums werden im Theorieteil geliefert.
Die Herleitung der beiden Forschungsfragen geschieht stringent. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass die Einführung der Forschungsfragen kontextuell verbunden mit der knappen Erläuterung zur sozialen Konstruktion elterlichen Vertrauens erfolgt. Hierdurch werden die vertrauenstheoretischen Grundlagen bezogen auf die Studie nicht nur weiter ausgeschärft, sondern auch methodische Fragen aufgeworfen und mit Blick auf die zwei Forschungsfragen besprochen.
Zum Design
Generell erscheint das Design geeignet, um die Forschungsfragen zu beantworten. Jedoch lassen sich auch einige Einschränkungen feststellen. Ein wesentlicher Kritikpunkt bezieht sich hierbei auf die geringe Stichprobengröße: von 23 geführten Interviews wurden 8 Interviews ausgewählt, auf denen die Befunde der Fallstudie – oder besser Pilotstudie – gründen. Eine Diskussion der geringen Fallzahl seitens der Autorinnen findet erst zum Ende des Beitrags statt. Zudem erfolgt die Darstellung der festgestellten Regelmäßigkeiten innerhalb der Fälle sowie der Zusammenhänge zwischen weiteren Merkmalen teils nur oberflächlich und intransparent. Auch ein konkretes Nachvollziehen der Interviewinhalte ist aufgrund fehlender methodischer Details nur eingeschränkt möglich. So werden beispielsweise die Interviewleitfäden nicht vollumfänglich präsentiert und von den transkribierten Interviews fließen nur kurze Sequenzen in den Beitrag ein. Die Replizierbarkeit ist dementsprechend als eher gering einzustufen und auch im Hinblick auf die Qualität der Datenaufbereitung sowie Validität und Generalisierbarkeit der Ergebnisse sind Einschränkungen vorhanden.
Problembewusst nennen die Autorinnen Schwerpunkte für Anschlussarbeiten: „Weitere empirische Untersuchungen zur Validierung von Typen elterlichen Vertrauens, ihrer Bedingungen und Herstellung sollten z. B. nicht nur ein größeres Sample realisieren, sondern den hier aus theoretischer Sicht mit dem Hinweis auf die Unvollständigkeit der Eltern-Schule-Beziehung skizzierten institutionellen Faktor sowie und [sic] die Bedeutung der Situation systematisch berücksichtigen“ (Bormann & Adamczyk, 2016, S. 180). Der Ausblick auf mögliche Anschlussuntersuchungen umfasst weitere Facetten und vermittelt prägnant, welche Anstrengungen im Forschungsfeld der Schule-Eltern-Beziehung mit besonderem Schwerpunkt auf den Faktor Vertrauen nunmehr anzugehen seien.
Zu den Ergebnissen
Trotz vorgetragener Kritikpunkte liefern die Autorinnen mit ihrer Fallstudie empirisch gestützte Antworten auf die zugrunde liegenden Forschungsfragen. Insofern ist das Ziel der Fallstudie erreicht. Anhand von acht Interviews wird erstmalig eine Typisierung des elterlichen Vertrauens gegenüber Schule angefertigt. Die Autorinnen geben ihrer Typisierung Gewicht: „Trotz der skizzierten Grenzen der Studie scheinen die hier ermittelten Typen grundsätzlich extern valide zu sein. Denn auch methodisch und methodologisch anders ausgerichtete Untersuchungen präsentieren durchaus ähnliche Elterntypen […]“ (Bormann & Adamczyk, 2016, S. 181). Die vorliegende Studie kann somit als „Startpunkt“ weiterer empirischer Arbeiten zum Thema Vertrauen in der Eltern-Schul-Beziehung angesehen werden und die erfolgte Typisierung kann als Grundlage für nachfolgende (quantitative und qualitative) Untersuchungen dienen.
Auch praktisch sind die ermittelten Befunde bedeutsam – zum Beispiel im Hinblick auf eine gezielte Elternarbeit der Schulen. Insbesondere der Befund, dass Eltern mit Primarschulkindern bei der Bildung eines Urteils bezüglich einer weiterführenden Schule je nach Vertrauenstyp unterschiedliche Wege der Informationsverarbeitung einschlagen, sollte Anlass zu einer variantenreicheren Elternarbeit der weiterführenden Schulen geben. Durch zielgruppengerechtere Informations- und Kontaktangebote könnten weiterführende Schulen derzeit bestehende Bildungsbenachteiligungen von Schülerinnen und Schülern aus bildungsferneren Milieus im Übergang vom Primarbereich in den Sekundarbereich abmildern.
Schulentwicklung NRW
Sie haben Fragen oder Anregungen?