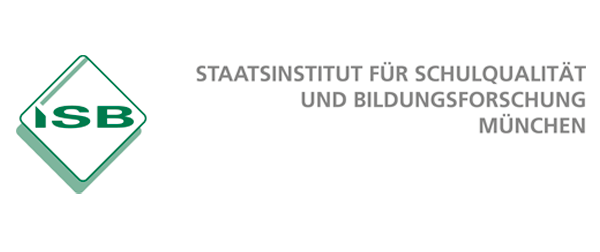Fragestellungen der Studie:
- Werden Förderpläne in inklusiven und separativen Schulformen gemäß den Vorgaben erstellt, Förderziele schriftlich festgehalten und die Förderpläne angepasst?
Rezension zur Studie
Moser Opitz, E., Pool Maag, S. & Labhart, D. (2019). Förderpläne: Instrument zur Förderung oder „bürokratisches Mittel“? Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen. Empirische Sonderpädagogik, 11(3), 210–224.FIS BildungFörderpläne sind ein zentrales Instrument der diagnostischen Arbeit im Bereich der Sonder- und Inklusionspädagogik. Sie bilden die Grundlage für den Förderplanungsprozess inklusive aller durchzuführenden Fördermaßnahmen. Doch wie sieht die Praxis aus? Das Autorenteam geht folgenden Forschungsfragen nach:
- Werden Förderpläne gemäß den Vorgaben erstellt, Förderziele schriftlich festgehalten und werden die Förderpläne angepasst? Zeigen sich Unterschiede zwischen integrativen und separativen Schulformen und sind die Regellehrkräfte über die Förderpläne informiert?
- Wie werden Förderpläne für die Festlegung von Lernzielen und die Unterrichtsgestaltung genutzt?
Hierzu wurde eine repräsentative Onlinebefragung von 226 Lehrkräften aus 16 Schulen eines schweizerischen Kantons durchgeführt. Die Daten wurden durch Häufigkeitsanalysen und Prüfung von Unterschiedshypothesen ausgewertet. Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden 25 pädagogische Fachkräfte ausgewählt und in Einzel- und Gruppeninterviews zu ihrem Umgang mit Förderplänen befragt. Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse.
Die Ergebnisse legen insbesondere im Hinblick auf integrative Sonderschulung den Schluss nahe, dass die meisten pädagogischen Fachkräfte die Legitimations- und Dokumentationsfunktion von Förderplänen anerkennen, trotz vorgebrachter Kritik an bürokratischen Belastungen durch die Förderplanerstellung. Die pädagogischen Fachkräfte erfüllen die verbindlichen Vorgaben der Förderplanerstellung. Dass darüber hinaus Förderpläne den Förderprozess strukturieren und mit ihnen ein konkretes Ziel verfolgt werden soll, wurde allerdings in den Interviews nie erwähnt. Zur integrativen Förderung werden Förderpläne ebenfalls häufig erstellt, die Zielsetzung erfolgt jedoch weitgehend orientiert am Klassenziel. Eine Verbindung zwischen Unterrichtsplanung und Förderplanung geht aus den Interviews nicht hervor.
Im Allgemeinen sind die Beschreibung des Designs, die Aufbereitung der Befunde und die Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen nachvollziehbar. Die Repräsentativität der Stichprobe hätte durch die Angabe weiterer Stichprobenmerkmale noch untermauert werden können.
Insgesamt liefert der Beitrag wichtige Erkenntnisse über die konkrete Nutzung von Förderplänen. Vor diesem Hintergrund wirft das Autorenteam die für Anschlussuntersuchungen relevante Frage auf, ob und wie Förderplanung und Unterrichtsplanung miteinander verbunden werden können.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Welche unterschiedlichen Funktionen von Förderplänen kenne ich?
- Welche der verschiedenen Förderplanfunktionen bestimmen meinen Umgang mit Förderplänen und welche Funktionen werden von mir aus welchen Gründen nicht bzw. kaum genutzt?
- Inwiefern greife ich bei der Beratung von Erziehungsberechtigten auf Förderpläne zurück?
- Wie kann die Gestaltung von Förderplänen optimiert werden?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Wie werden in der von mir geleiteten Schule Förderziele dokumentiert und den betreffenden Kolleginnen und Kollegen zugänglich gemacht?
- Wie sichere ich verbindlich die Qualität der Förderpläne in der von mir geleiteten Schule?
- Besteht an der von mir geleiteten Schule eine Vereinbarung, ob und wie Förderplanung und Unterrichtsplanung miteinander zu verbinden sind?
Moser Opitz, Pool Maag und Labhart weisen einleitend darauf hin, dass Lehrkräfte die Aufgabe haben, ihre Schülerinnen und Schüler ausgehend von den diagnostizierten Lernvoraussetzungen zu fördern. Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf gelte der Förderplan als ein zentrales Instrument der förderdiagnostischen Arbeit.
Förderpläne sind Dokumente, auf deren Grundlage eine gezielte Förderung von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf geplant werden kann. Insofern bildeten Förderpläne die Basis des konkreten Förderplanungsprozesses inklusive aller durchzuführenden Fördermaßnahmen. Förderplanung und Förderdiagnostik folgten hierbei einem zirkulären Muster:
- Erfassung der Lern- und Verhaltensvoraussetzungen (Ist-Stand)
- Planung von Unterricht und spezifischem Förderangebot
- Durchführung von Unterricht und spezifischem Förderangebot
- Evaluation der Wirksamkeit der angewandten Maßnahmen
Hierbei könnten Förderpläne verschiedene Funktionen erfüllen:
- Zielgerichtete und effektive Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf
- Strukturierung der individuellen Lernprozesse
- Legitimation und Dokumentation der Förderung
- Evaluation und Kontrolle von Lehr-Lernprozessen
Trotz der hohen Bedeutung von Förderplänen in inklusiven und separativen Schulformen (vgl. KMK 2010, 2011), gebe es nur wenige empirische Befunde zu ihrem Einsatz. Während einige Lehrkräfte kritisierten, dass Förderpläne eine zeitintensive und zugleich bedeutungslose Bürokratie darstellen, nähmen andere diese zum Anlass, mit Eltern ins Gespräch zu kommen (Müller et al., 2017). Zudem bestünden anhaltende Diskussionen über die Ableitung von Förderzielen aus Beobachtungen (z. B. Schlee, 2008).
Angesichts der hier skizzierten Forschungslage sowie der bestehenden Forschungslücke hinsichtlich des Einsatzes von Förderplänen formulieren Moser Opitz et al. zwei Forschungsfragen, von denen sich die erste Forschungsfrage in drei Subfragen untergliedert:
- A) Werden Förderpläne in inklusiven und separativen Schulformen gemäß den Vorgaben erstellt, werden Förderziele schriftlich festgehalten und werden die Förderpläne angepasst?
B) Zeigen sich zwischen integrativen und separativen Schulformen Unterschiede bezüglich des Umgangs mit Förderplänen?
Aufgrund der stark sonderpädagogischen Tradition von Förderplänen geht das Autorenteam von einer verstärkten Nutzung dieser in separativen Settings aus.
C) Sind die Regellehrkräfte über die Förderpläne informiert? - Wie werden Förderpläne für die Festlegung von Lernzielen und die Unterrichtsgestaltung genutzt?
Zur Beantwortung der Forschungsfragen führten Moser Opitz et al. zum einen eine schriftliche Onlinebefragung (Forschungsfragen 1A-1C) und zum anderen mündliche Befragungen (Forschungsfrage 2 sowie deskriptive Ergänzungen zu den Forschungsfragen 1A-1C) durch.
Die Erhebung wurde in einem Schweizer Kanton durchgeführt. Das schweizerische Schulsystem zeichnet sich aus durch die Unterscheidung von niederschwelligen Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, sowie soziale und emotionale Entwicklung und verstärkte Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten geistige, körperliche und motorische Entwicklung.
Während die Schülerinnen und Schüler in niederschwelligen Maßnahmen entweder inklusiv oder in Kleinklassen unterrichtet werden, werden Schülerinnen und Schüler in verstärkten Maßnahmen entweder inklusiv oder an einer Sonderschule beschult.
Für die schriftliche Onlinebefragung wurden zunächst 908 schulische Fachkräfte aus 16 Schulen via E-Mail angeschrieben, von denen sich 41.6 % zurückmeldeten. Aus diesem Pool wurde eine Stichprobe von 226 Lehrkräften (65.9 % weiblich, MAlter = 43.82 Jahre) ausgewählt, die zum Befragungszeitpunkt Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf unterrichteten. Die repräsentative Stichprobe setzt sich wie folgt zusammen:
- 134 Regellehrkräfte (RLK), bestehend aus 108 Primarstufen-RLK und 26 Sekundarstufen-RLK
- 75 Förderlehrkräften (FLK, Sonderpädagoginnen und -pädagogen an Regelschulen), bestehend aus 66 Primarstufen-FLK und 2 Sekundarstufen-FLK
- 17 Kleinklassenlehrkräfte (KLK)
Für die Beantwortung der einzelnen Fragen (Forschungsfragen 1A-1C, Beispielitem: „Ich kenne den Lernstand der SuS mit Förderbedarf“) standen den Lehrkräften eine sechsstufige Likert-Skala (1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 6 = „trifft genau zu“) sowie die Option „keine Antwort möglich“ zur Verfügung. Die Antworten wurden mittels Häufigkeitsanalysen und der Prüfung von Unterschiedshypothesen auf ordinalem Skalenniveau ausgewertet. Aufgrund zu geringer Nennungen wurden die beiden Randkategorien für die Beantwortung der Fragestellung jeweils zusammengefasst. Zur Beantwortung von Forschungsfrage 2 wurden Experteninterviews mit 25 Lehrkräften durchgeführt. Hierzu wurden Einzelinterviews mit zwei KLK der Sekundarstufe und elf Gruppeninterviews mit zwei bis vier Lehrkräften durchgeführt (11 RLK, 12 FLK). Die Interviews fanden im Anschluss an einen Unterrichtsbesuch statt und enthielten folgende Fragen (Moser Opitz et al., 2019, S. 215):
- Wie gehen Sie beim Erstellen der Förderpläne vor?
- Wie gehen Sie vor, um die Lernziele für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf festzulegen?
- Welche Rolle spielen die Förderpläne bei ihrer Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung?
Die Auswertung aller Interviews erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse unter Verwendung des Programms MAXQDA 12.
Forschungsfrage 1A
Werden Förderpläne in inklusiven und separativen Schulformen gemäß den Vorgaben erstellt, werden Förderziele schriftlich festgehalten und werden die Förderpläne angepasst?
90 % der FLK und 94.1 % der KLK kennen den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler. Das Vorhandensein von Förderplänen bestätigen 58.3 % der FLK (25 %:„eher“) sowie 41.2 % der KLK (41.2 %: „eher“). 81.7 % der FLK bzw. 70.7 % der KLK geben an, die Förderziele schriftlich festzuhalten. An dieser Stelle akzentuieren die Autorinnen und Autoren insbesondere die Diskrepanz zwischen dem Vorhandensein der Förderpläne und schriftlichem Festhalten der Förderziele bei den KLK. Eine regelmäßige Anpassung erfolgt bei 76.7 % der FLK und 64.7 % der KLK.
Forschungsfrage 1B
Zeigen sich zwischen integrativen und separativen Schulformen Unterschiede bezüglich des Umgangs mit Förderplänen?
Bezüglich der Erstellung und Anpassung von Förderplänen bestehen zwischen RLK und FLK keine signifikanten Unterschiede. Jedoch verschriftlichen FLK die Förderziele signifikant häufiger als die KLK (z = -2.37, p < .05, r = 0.27).
Forschungsfrage 1C
Sind die Regellehrkräfte über die Förderpläne informiert?
Fast 63 % der RLK geben an, dass das Vorliegen von Förderplänen zutrifft bzw. eher zutrifft. Das Vorhandensein von Förderplänen für Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Maßnahmen bestätigen knapp 67 % der RLK. Hervorzuheben ist, dass pro Item 20 % bis 25 % der RLK, die Antwortoption „keine Antwort möglich“ wählten.
Forschungsfrage 2
Wie werden Förderpläne für die Festlegung von Lernzielen und die Unterrichtsgestaltung genutzt?
Die induktive Auswertung der Interviewdaten ergab sechs Kategorien, von denen die folgenden vier in der vorliegenden Studie Berücksichtigung fanden:
- Umsetzung der Förderung
- Vorgehen bei der Förderplanung
- Förderziele festlegen
- keine Förderpläne
Sekundarstufe: Insbesondere mit dem Argument, den bürokratischen Aufwand möglichst gering zu halten, begründen die FLK in der Sekundarstufe, dass sie ausnahmslos ohne Förderpläne und Förderdiagnostik arbeiten. Dieser entlastende Ansatz schließe jedoch nicht aus, dass die FLK Förderziele bestimmen. In den Kleinklassen der Sonderschulen würden allenfalls teilweise individuelle Lernziele formuliert. Dies erfolge allerdings nicht auf Basis von Förderplänen, sondern anhand des Lehrplans der Regelklasse (Realschule), um nach Besuch der Kleinklasse in der Sonderschule einen leichteren Berufseinstieg zu ermöglichen. Lehrkräfte aus dem inklusiven Modell berichten in den Interviews, dass verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler in ein niedrigeres Niveau oder eine niedrigere Stammklasse versetzt würden – allerdings ohne festgelegtes Verfahren und ohne Förderplan. Mit Blick auf die Förderpraxis der Sekundarstufe zeichnet sich die Tendenz ab, dass FLK gezielte Fördermaßnahmen entwickeln. Dies geschehe allerdings weitgehend losgelöst von Förderplänen.
Primarstufe: Bei integrativen Sonderschulen ist die Förderplanung vorgeschrieben und wird vom Heilpädagogischen Zentrum geprüft. Eine regelmäßige Erstellung von Förderplänen sei daher Standard. Aus Beobachtungen und weiteren diagnostischen Verfahren leite man dann die Formulierung von Förderzielen ab. Die Förderplanung diene insbesondere der Dokumentation von Selektionsentscheidungen, während die Lehrkräfte den Nutzen der Förderplanung weitgehend in Frage stellen. Bezüglich der integrativen Förderung berichten die FLK, dass, basierend auf Beobachtungen oder Lernstanderhebungen an halbjährlich geführten Standortgesprächen, Förderziele abgeleitet würden, die Verschriftlichung der Gespräche jedoch nicht nach standardisiertem Muster erfolge. In der Regel würden von den FLK keine Förderpläne erstellt, da ohnehin am Klassenstoff gearbeitet würde. Dies mache eine Förderplanerstellung überflüssig. Schulleitungen würden Förderpläne zudem nicht einfordern.
Zusammenfassend ist bezüglich der integrativen Sonderschulung zu konstatieren, dass die Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte, trotz vorgebrachter Kritik an bürokratischen Belastungen durch die Erstellung von Förderplänen, deren Legitimations- und Dokumentationsfunktion anerkennt und die verbindlichen Vorgaben der Förderplanerstellung erfüllt. Insofern kommt den Förderplänen vor allem bei Übergabegesprächen infolge eines Personalwechsels eine wichtige Funktion zu. Dass Förderpläne den Förderprozess strukturieren und mit ihnen ein konkretes Ziel verfolgt werden soll, wurde in den Interviews nie erwähnt. Im Hinblick auf integrative Förderung herrscht in der Förderpraxis – besonders in der Sekundarstufe – eine Orientierung am Klassenziel vor. Die Autorinnen und Autoren stellen hierzu fest, dass keine Verbindung zwischen Unterrichtsplanung und Förderplanung bestehe.
Hintergrund
Moser Opitz, Pool Mag und Labhart arbeiten prägnant das Spannungsfeld zwischen den institutionellen Förderplanvorgaben einerseits und der von Regellehrkräften (RLK) und Förderlehrkräften (FLK) eher als bürokratisch und für die weitere Förderpraxis als nutzlos empfundene Förderplanerstellung andererseits heraus. Klar sowie knapp wird das Instrument Förderplan inklusive seiner verschiedenen Funktionen und Phasen erläutert. Hier heben die Autorinnen und Autoren die schwankende Qualität der Zielformulierungen innerhalb der erstellten Förderpläne hervor und dokumentieren die dünne Forschungslage bezüglich der separativ- und inklusionspädagogischen Förderpraxis in Deutschland und der Schweiz. Die Forschungsfragen leiten sich logisch ab aus den beschriebenen Ausführungen zur Förderplanungspraxis und mangelnden empirischen Erkenntnissen hierzu.
Design
Im Allgemeinen scheint das gewählte Design angemessen, um die Forschungsfragen sinnvoll zu beantworten. Positiv hervorzuheben ist insbesondere der „Mixed-Method-Ansatz“, also die Integration quantitativer und qualitativer Befunde. Von kleineren Details abgesehen, erfolgt die Datenerhebung nachvollziehbar und die Auswertung der Daten sachgerecht. Etwas Kritik ist an der Beschreibung der Stichprobe der zugrundeliegenden Studie zu üben. Aufgrund der Formulierung ist nicht zweifelsfrei rekonstruierbar, ob die 226 Lehrkräfte alle Lehrkräfte umfassen, die zum Zeitpunkt der Befragung Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf unterrichteten, oder ob dies noch auf weitere, nicht ausgewählte Lehrkräfte zutraf. Unklar ist bezüglich der Stichprobe ferner, wie sich deren Zusammensetzung im Verhältnis zu allen Lehrkräften verhält, die in dem untersuchten Kanton (und idealerweise in der Schweiz) mit Förderplänen arbeiten müssen. Die Repräsentativität wird durch die Autorinnen und Autoren bestätigt, könnte aber durch die Nennung weiterer Stichprobenmerkmale untermauert werden. Problembewusst weisen die Autorinnen und Autoren darauf hin, dass die Stichprobe der Kleinklassenlehrkräfte (KLK) aufgrund nur noch weniger Kleinklassen spärlich ausfällt. Warum bei der Interviewanalyse von den induktiv gebildeten sechs Kategorien nur vier für die Studie berücksichtigt werden, bleibt mit Verweis auf die Forschungsfragen weitgehend offen. Ein möglicher Grund könnte gemäß Tabelle 4 (vgl. Moser Opitz et al., 2019, S. 217) in der geringen Zahl an Nennungen liegen – sicher ist dies jedoch nicht.
Ergebnisse
Die Zielstellung der Untersuchung wurde erreicht, da die übergeordneten zwei Forschungsfragen, von einigen Unklarheiten im Design (s. o.) abgesehen, nachvollziehbar beantwortet sind. Im Prozess dieser Beantwortung sind keine logischen Brüche oder Widersprüche feststellbar. Die Darstellung erfolgt klar und passenderweise getrennt für unterschiedliche Fördersettings.
Zutreffend schränken Moser Opitz et al. ein, dass sich aus der Untersuchung keine Aussagen zur Qualität und Wirkung von Förderplänen ableiten lassen. Trotzdem liefert die Untersuchung wichtige Impulse, um den kritischen Blick auf Förderpläne als integralen Baustein der Förderpraxis zu schärfen und Anschlussforschungen zu initiieren. Bedauerlich ist der Umstand, dass das Autorenteam auf die zu erwartende Bürokratie-Kritik an Förderplänen nicht konsequent mit konstruktiven Nachfragen in den Interviews reagieren (z. B.: Worin genau besteht die unnötige Bürokratie? An welchen Stellen lassen sich aus Sicht der Lehrkräfte bürokratische Hürden reduzieren? Wo sehen Lehrkräfte Entwicklungspotenziale im Bereich der Förderpläne?). Die vorliegende Untersuchung liefert demnach also eher eine Beschreibung, nicht aber eine tiefergehende Analyse der aktuellen Situation.
Für nachfolgende Untersuchungen leiten Moser Opitz et al. hinsichtlich der empirisch konstatierten Trennung von Förderplanung und Unterrichtsplanung eine wichtige Anschlussfrage ab: Ob und wie können Förderplanung und Unterrichtsplanung miteinander verbunden werden? Hierbei handelt es sich um eine Forschungslücke, die in Anbetracht des sozialpolitischen Willens nach mehr Inklusion dauerhaft schwer akzeptabel scheint.
Schulentwicklung NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Sie haben Fragen oder Anregungen?
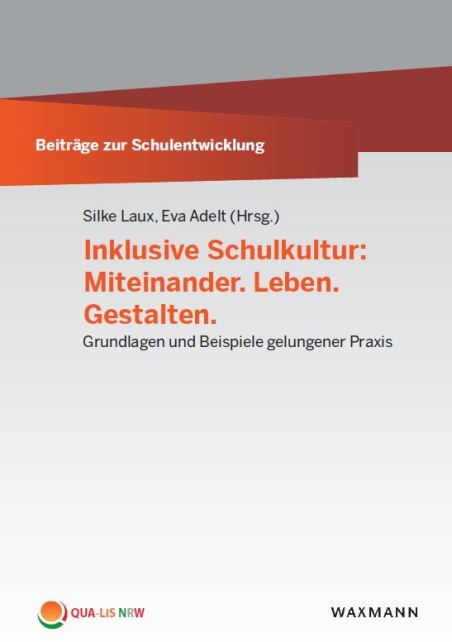 Inklusive Schulkultur
Inklusive Schulkultur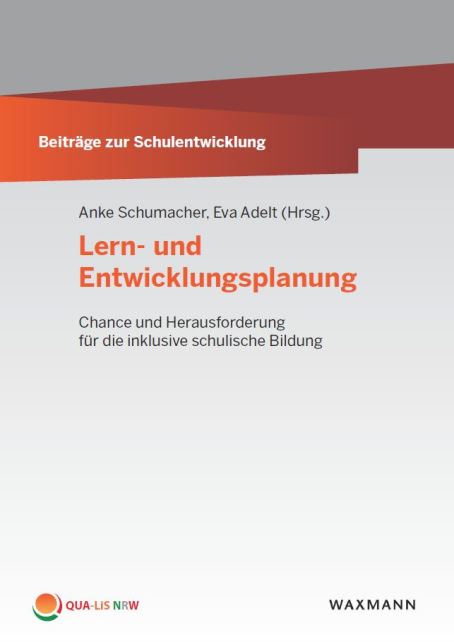 Lern- und Entwicklungsplanung
Lern- und Entwicklungsplanung