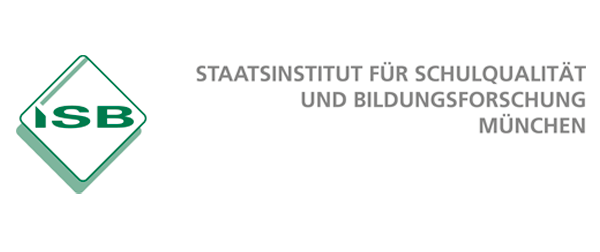Fragestellungen der Studie:
- Wie wirkt sich ein sprachenintegrativer und -reflexiver Deutschunterricht auf die Sprachbewusstheit von ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern aus?
Rezension zur Studie
Wildemann, A. & Bien-Miller, L. (2022). Warum lebensweltlich deutschsprachige Schülerinnen und Schüler von einem sprachenintegrativen Deutschunterricht profitieren – empirische Erkenntnisse. Zeitschrift für Grundschulforschung, 15, 151–167.FIS BildungIm Rahmen eines sprachenintegrativen Deutschunterrichts in der Grundschule soll die Sprachbewusstheit der Schülerinnen und Schüler angeregt werden. Dabei werden die Kinder mit anderen Sprachen in Kontakt gebracht und zur Sprachreflexion angeregt. Bei diesen Sprachen kann es sich um die Herkunftssprache der Kinder oder um Fremdsprachen handeln. Insbesondere im Rahmen der deutschsprachigen Forschung ist bislang kaum geklärt, wie sich ein sprachenintegrativer und -reflexiver Deutschunterricht auf die Sprachbewusstheit von lebensweltlich ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern am Ende der Grundschulzeit auswirkt.
Um dies zu klären, wurden 409 Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 in einer Studie im Experimental-Kontrollgruppen-Design mit drei Messzeitpunkten untersucht: Nachdem 18 Lehrkräfte entsprechend eingewiesen waren, wurden die Schülerinnen und Schüler in einem sprachenintegrativen Unterricht beschult. Die Durchführung dieses Unterrichts wurde in Form eines digitalen Tagebuchs durch die Lehrkräfte dokumentiert. Mithilfe einer Software, die Geschichten in 5 frei wählbaren Sprachen anbot, sowie von Reflexionsimpulsen durch die Lehrkraft wurde die Sprachreflexion angestrebt. Aus den Häufigkeiten der sprachreflexiven Äußerungen wurden Mittelwerte gebildet. Es zeigt sich, dass:
- Kinder aus der Experimentalgruppe stärker durch sprachenintegrativen Unterricht in ihrer Sprachbewusstheit gefördert wurden als Kinder der Kontrollgruppe,
- Schülerinnen und Schüler mit lebensweltlich einsprachigem Hintergrund – anders als von den Autorinnen erwartet – stärker gefördert wurden als solche mit mehrsprachigem Hintergrund,
- offenbar die zweite Hälfte der Grundschulzeit ein Zeitraum ist, in dem die Sprachbewusstheit stark zunimmt.
Die Studie klärt ein Forschungsdesiderat. Allerdings gibt es Unschärfen bei der Beschreibung der Methodik, einige Begriffe könnten präziser definiert sein, beispielsweise könnte die Sprachbewusstheit nach unterschiedlichen Modulen der Sprache (Syntax, Lexikon…) analysiert werden.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Welche Beobachtungen habe ich zur Sprachbewusstheit von Kindern meiner Klasse gemacht? Gibt es diesbezüglich Differenzen zwischen lebensweltlich ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern? Gibt es dementsprechend unterschiedlichen Förderbedarf?
- Welche Ressourcen kenne/habe ich, um Sprachbewusstheit zu fördern? Sehe ich in der in der Studie aufgezeigten Methodik einen Weg, um dies zu tun?
- Wie begegne ich Mehrsprachigkeit in meinem Unterricht? Nutze ich neben der Möglichkeit, Mehrsprachigkeit im Unterricht zuzulassen (indem die Kinder z. B. gezielt auf ihre Muttersprache zurückgreifen) auch Optionen, den Umgang mit verschiedenen Sprachen explizit einzufordern, um mir die Vorteile zunutze zu machen?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Welche sprachlichen Ressourcen gibt es an unserer Schule? Welche Sprachen bringen die Kinder mit in die Schule?
- Wie wird die Mehrsprachigkeit von Kindern bereits an unserer Schule berücksichtigt?
- Kennen die Lehrkräfte die (mehr)sprachlichen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler?
- Inwiefern wird Mehrsprachigkeit toleriert oder gar als Ressource geschätzt und im Unterricht gezielt genutzt?
- Welche Haltung wird von der Schule aus gegenüber Mehrsprachigkeit gezeigt und erwartet?
- Inwiefern werden die Lehrkräfte dazu angehalten, Mehrsprachigkeit als Potential für ihren Unterricht zu nutzen?
Einleitend verweisen Wildemann und Bien-Miller darauf, dass die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen oder Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler in einem sprachenintegrativen Deutschunterricht als Ressource betrachtet werden. Dabei kann es sich bei den Sprachen, welche neben Deutsch zum Einsatz kommen, sowohl um die Herkunftssprache der Kinder als auch um Fremdsprachen handeln, mit denen die Kinder in Kontakt (gekommen) sind.
Obwohl es eine Reihe von Konzepten zur Einbeziehung zusätzlicher Sprachen in den Deutschunterricht gebe, seien diese bislang kaum evaluiert bzw. auf ihre Wirksamkeit hin überprüft worden. Während in internationalen Studien zu sprachenintegrativem Unterricht mehrsprachige Kinder gegenüber ihren monolingualen Vergleichsgruppen bei unterschiedlichen Aufgabenformaten regelhaft überlegen seien, seien die Befunde bei den Studien im deutschsprachigen Bereich nicht eindeutig. Zugleich lasse sich aus der insgesamt überschaubaren Zahl von Untersuchungen vorsichtig schlussfolgern, dass Mehrsprachigkeit eine Ressource für den Aufbau von Sprachbewusstheit darstellen könnte. Allerdings bleibe unklar, welche unterrichtspraktischen Möglichkeiten sich hieraus ergeben, und ob einsprachige und mehrsprachige Kinder gleichermaßen von einem solchen Unterricht profitieren.
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt „MehrSprachen“ ein. In dem Projekt wird ein sprachenintegrativer und -reflexiver Deutschunterricht in der Grundschule im Rahmen einer sechsmonatigen Intervention bei Kindern der Jahrgangsstufen 3 und 4 auf die Fragestellung hin untersucht, inwiefern er sich auf die Sprachbewusstheit lebensweltlich ein- und mehrsprachiger Schülerinnen oder Schüler auswirkt.
Sprachbewusstheit umfasst zum einen die Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung von Sprache kontrolliert zu lenken (z. B. durch Selbstkorrekturen). Zum anderen ist die Sprachanalyse relevant, bei der implizites sprachliches Wissen zu explizitem, metasprachlichen Wissen weiterentwickelt wird.
Dementsprechend sehen die Autorinnen metasprachliche Äußerungen als Indikatoren für Sprachbewusstheit, die aus sprachlichen Erfahrungen erwachse und dementsprechend möglicherweise durch unterrichtliches Handeln (explizites Thematisieren sprachlicher Funktionen oder Formen) positiv zu beeinflussen sei.
Letztlich zielen die Forschungsaktivitäten auf die Prüfung zweier Hypothesen:
- Kinder, die einen sprachenintegrativen Unterricht erhalten, entwickeln ein höheres Maß an Sprachbewusstheit als Kinder einer Kontrollgruppe ohne Intervention.
- Lebensweltlich mehrsprachige Kinder profitieren in Bezug auf die Sprachbewusstheit stärker von sprachenintegrativem Unterricht als lebensweltlich einsprachige Kinder.
Die Untersuchung fußt auf einer vorangehenden „Hybrid-Delphi-Studie“ von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Unterrichtspraxis. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die unterrichtliche Praxis wurden mit dem Konzept der Didaktik der Vielsprachigkeit nach Oomen-Welkes (2017) zusammengeführt.
Für den zu entwickelnden Unterricht ergaben sich daraus zwei Säulen:
- Explizite Thematisierung von Sprache (= Sprachen werden systematisch integrativ fokussiert).
- Funktionale Sprachreflexion (= Thematisierung von Sprachen im Kontext lebensweltlicher und durch Fremdsprachenunterricht erzeugter Mehrsprachigkeit).
Die 18 Lehrkräfte der Experimentalgruppe wurden im Rahmen einer sechsmonatigen Fortbildung ausgebildet (24 Stunden Fortbildungszeit und Erprobungsphasen im Unterricht). Anschließend dokumentierten die Lehrkräfte in einem digitalen Tagebuch die Durchführung des sprachenintegrativen Unterrichts.
In einem Experimental-Kontrollgruppen-Design wurden im Vorfeld der Intervention Sprachkompetenz(en) (Verfahren: „Tulpenbeet“), allgemeine kognitive Fähigkeiten (Verfahren: CFT 20-R) und demographische Daten der Schülerinnen und Schüler erfasst. Unmittelbar im Anschluss an die Intervention und zusätzlich ein halbes Jahr danach wurde die Sprachbewusstheit (Verfahren: M-SPRA) erfasst.
Stichprobe
409 Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 aus 21 Grundschulen nahmen an der Studie teil: 191 (46,7 %) waren lebensweltlich einsprachig, 218 (53,3 %) mehrsprachig. Ein Schülerfragebogen erfasste Daten zu Alter, Geschlecht, Geburtsort (von Kind und Eltern), sowie zur Sprachverwendung in Familie bzw. Peergroup.
Daten zum sozioökonomischen oder soziokulturellen Hintergrund der Kinder wurden nicht erfasst.
Die Autorinnen gehen angesichts der Teilnehmerzahl und des ausgewogenen Anteils von ein- bzw. mehrsprachigen Kindern von einer ausreichenden Vergleichbarkeit der Daten aus, zugleich weise die Stichprobe bei den Sprachkompetenzen (im Deutschen) und den kognitiven Fähigkeiten eine Normalverteilung auf.
Erhebungsinstrumente
Das Verfahren M-SPRA gewinnt sprachliche Daten durch die Aufforderung an Schülerinnen oder Schüler, Gedankengänge bei der Lösung einer sprachvergleichenden Aufgabe zu verbalisieren und damit offenzulegen. Bei der Entwicklung der sprachvergleichenden Aufgabe wurde neben einer größtmöglichen Standardisierung zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Schülerleistungen auch eine größtmögliche Offenheit der Aufgabenstellung angestrebt, um ein breites linguistisches Spektrum bei den metasprachlichen Äußerungen zu gewährleisten.
Sprachliche Vorlagen sind die Geschichten „Maddox, der Magier“ und „Die Geschichte vom Eis“ der Software „My First Stories“. Diese stellt kindgerechte Erzählungen in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Türkisch) zum Lesen und Hören zur Verfügung und erlaubt, jederzeit zwischen den Sprachen zu wechseln.
Auf dieser Basis kommen zwei Reflexionsimpulssets mit jeweils fünf Impulsaufgaben zum Einsatz, die auf unterschiedliche linguistische Ebenen abzielen. Das erste Impulsset (Jahrgangsstufe 3) zielt auf Wissen, das durch selbständige gedankliche Auseinandersetzung mit Sprache aufgebaut wurde; das zweite Set (Jahrgangsstufe 4) erfasst zudem die im Unterricht erworbenen metasprachlichen Kenntnisse.
Jeweils zwei Kinder bildeten ein Team, das die mehrsprachige Software bediente. Während der Textrezeption setzte die Testleitung an den dafür vorgesehenen Stellen einen Reflexionsimpuls. In der Interaktion mit der Testleitung verbalisierten die Kinder ihre sprachbezogenen Vorstellungen. Die metasprachlichen Interaktionen wurden nach Videoaufzeichnungen transkribiert und in Bezug auf den Inhalt ausgewertet. Die Zahl der dabei festgestellten metasprachlichen Äußerungen bildet den Globalwert für die Sprachbewusstheit, der in die statistischen Analysen einging.
Auswertung
Zur Kodierung, Skalierung, Berechnung und Auswertung der erfassten Daten machen die Autorinnen wenig explizite Angaben, sie müssen zum Teil aus dem Material oder der Sekundärliteratur erschlossen werden.
Es fand jeweils eine Kontrolle der Berechnungen im Hinblick auf Sprachkompetenz und allgemeine kognitive Fähigkeiten statt. Die Sprachbewusstheit von Experimental- und Kontrollgruppe wurde auf der Basis von deskriptiver Statistik ermittelt; der Vergleich von (Sub)gruppen erfolgte mittels Kovarianzanalysen.
Wirksamkeit der Intervention
Unter Kontrolle der Sprachkompetenz und der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten erreichen die Kinder der Experimentalgruppe zum 2. Messzeitpunkt höhere Sprachbewusstheitswerte als die Kinder der Kontrollgruppe; dieser Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe ist signifikant.
Ein signifikanter Vorsprung der Experimentalgruppe zeigt sich ebenfalls bei lebensweltlich einsprachigen Kindern; sie weisen auch sechs Monate später noch signifikant höhere Werte auf als einsprachige Kinder der Kontrollgruppe. Die mehrsprachigen Kinder der Experimentalgruppe erreichen lediglich deskriptiv höhere Werte in ihrer Sprachbewusstheit als die mehrsprachigen Kinder der Kontrollgruppe.
Die Autorinnen sehen ihre erste Hypothese als bestätigt an, nach der Kinder der Experimentalgruppe mit Intervention höhere Sprachbewusstheitswerte erreichen als Kinder der Kontrollgruppe ohne Intervention.
Mehrsprachigkeit und Sprachbewusstheit
Zu beiden Messzeitpunkten (2 und 3) gibt es innerhalb der Experimentalgruppe keine nennenswerten Unterschiede bezüglich der Sprachbewusstheit zwischen den lebensweltlich ein- und mehrsprachigen Kindern. Anders verhält es sich in der Kontrollgruppe: Lebensweltlich mehrsprachige Kinder zeigen zu beiden Zeitpunkten eine konstant signifikant höhere Sprachbewusstheit als Einsprachige.
Wildemann et al. vermuten, dass den lebensweltlich mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern durch das Aufwachsen in mehreren Sprachsystemen bereits eigene Ressourcen für einen Sprachvergleich zur Verfügung stehen. Das Bereitstellen solcher Ressourcen im Rahmen einer recht kurzen Intervention führe bei mehrsprachigen Kindern hiernach nicht zu einem Wachstum ihrer Sprachbewusstheit. Für die einsprachigen Schülerinnen und Schüler gelte das Gegenteil, da bereits das Kennenlernen solch grundlegender Ressourcen zum Sprachvergleich zu einer Verbesserung ihrer Sprachbewusstheit führen könne.
Damit muss die zweite Hypothese zurückgewiesen werden: Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler profitieren offenbar nicht in besonderem Maße von sprachenintegrativem Unterricht. Viel stärker profitieren die lebensweltlich Einsprachigen.
Entwicklung der Sprachbewusstheit in der zweiten Hälfte der Grundschulzeit
Aus dem starken und signifikanten Anstieg der Sprachbewusstheit zwischen Messzeitpunkt 2 und 3 in Experimental- und Kontrollgruppe schließen die Autorinnen, dass die zweite Hälfte der Grundschulzeit eine Phase ist, in der sich die Sprachbewusstheit stark entwickelt. Diese Entwicklung sei unabhängig davon, ob der Unterricht sprachenintegrativ sei oder nicht; von Bedeutung sei eventuell die allgemeine sprachliche und kognitive Entwicklung der Kinder in diesem Alter. Aufgrund der stark unterschiedlichen Entwicklungsverläufe (hohe Standardabweichungen sowie Abweichungen zwischen den untersuchten Schulen) müssten allerdings weitere, noch unbekannte Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Sprachbewusstheit vermutet und folglich untersucht werden.
Die Studie liefert Evidenz dafür, dass ein sprachenintegrativer Deutschunterricht, der Mehrsprachigkeit zur Sprachreflexion nutzt, zu einer höheren Sprachbewusstheit führt als „regulärer“ Deutschunterricht. Sowohl lebensweltlich ein- als auch mehrsprachige Kinder profitieren von derartigem Unterricht. Zugleich zeigt die Untersuchung, dass sich die Sprachbewusstheit in der zweiten Hälfte der Grundschulzeit stark entwickelt – dies gilt auch für den regulären Deutschunterricht. Insofern bestätigt die Studie Annahmen und Befunde bisheriger Forschung.
Unerwartet ist hingegen der Befund, dass vor allem einsprachige Kinder von sprachenintegrativem Unterricht profitieren und ihren Rückstand bezüglich der Sprachbewusstheit gegenüber den Mehrsprachigen aufholen können.
Die Bedeutung der Untersuchung von Wildemann et al. wird vor dem Hintergrund folgender Aspekte ersichtlich: Zum einen stellen in Deutschland sowohl ein- als auch mehrsprachige Schülerinnen und Schüler große Anteile an der Gruppe der (Grund-)Schulkinder dar. Zum anderen ist die Forschungslage zur Wirkung sprachenintegrativen Unterrichts auf diese Gruppen alles andere als eindeutig.
Wichtige Fragen bleiben allerdings offen. Es handelt sich bei der „Mehrsprachigkeit“ möglicherweise weniger um eine klar abgrenzbare Kategorie als um ein Kontinuum: Kinder dürften im Alltag abseits der Schule je nach konkreten Lebensumständen die deutsche und die nichtdeutsche Sprache in unterschiedlichem Ausmaß verwenden (im Kontakt mit Freunden, im Alltag abseits von Familie und Schule, im Förderunterricht, …), so dass hier evtl. präzisere Daten zum konkreten Sprachgebrauch vertiefte Einblicke geben würden. Es wäre z. B. denkbar, dass je nach Familiensprache ein Leben in Deutschland unterschiedlich leicht oder schwer zu organisieren wäre, da den Kindern in unterschiedlichem Ausmaß im Alltag Menschen gegenüberstehen, die ihre Familiensprache beherrschen. Folglich könnte der Umfang, in dem die Kinder die jeweiligen Sprachen verwenden müssen, in breiten Intervallen schwanken. Auch wäre denkbar, dass innerhalb von Familien mehrere Sprachen nebeneinander verwendet werden, was offenbar nicht abgefragt wurde. Daraus könnte sich eine unterschiedlich starke Sprachbewusstheit je nach Familiensprache ergeben.
Vermutlich zu Recht vermuten die Autorinnen zudem, dass sich hinter der breiten Streuung der Ergebnisse noch nicht bekannte Faktoren aus der konkreten Unterrichtsgestaltung verbergen, die nicht Gegenstand der Untersuchung sind (aber zukünftige Studien anregen könnten und sollten). Hier wäre vor allem mit Blick auf die lebensweltlich mehrsprachigen Kinder zu prüfen, inwiefern der Unterricht an ihre Fähigkeiten anknüpft und darauf abzielt, diese möglichst zu erweitern, sodass im Unterricht nicht ggf. lediglich Inhalte dargeboten werden, die diese Kinder bereits kennen (Ressourcen zum Sprachvergleich).
Auch stellt es sich nicht als einfach dar, das Design der Untersuchung zu beurteilen; hierzu wären zusätzliche Informationen nötig. Die Strukturierung als Experimental- vs. Kontrollgruppen-Design mit drei Messzeitpunkten ist sinnvoll, die Betrachtung der Jahrgangsstufen 3 und 4 gut gewählt (sie erfasst einen frühen Zeitpunkt der schulischen Entwicklung von Sprachbewusstheit), zumal die Untersuchung die starke Entwicklung der Sprachbewusstheit in diesem Zeitraum stützen kann. Jedoch wird das Untersuchungsergebnis nur dann auch angemessen in die Entwicklung der Sprachbewusstheit einzuordnen sein, wenn man auch andere Jahrgangsstufen entsprechend untersucht.
Darüber hinaus bleibt in Bezug auf das Design offen, warum die Sprachbewusstheit der Kinder nicht bereits zu Messzeitpunkt 1 erhoben wurde. Mit den vorliegenden Daten kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass Unterschiede zu Messzeitpunkt 2 bzw. Messzeitpunkt 3 bereits vor der Intervention vorlagen. Aus diesem Grund sind die Befunde mit besonderer Vorsicht zu interpretieren.
Ebenso bleibt das konkrete Vorgehen bei der Kodierung und Berechnung der Befunde zum Teil unklar: Was genau als sprachreflexive Äußerung gewertet wird und wie daraus die in den Texten und Grafiken präsentierten Zahlen werden, bleibt zumindest so lange nur schemenhaft erkennbar, bis man evtl. zusätzliche von den Autorinnen zitierte Literatur heranzieht. So wäre wünschenswert zu wissen, ob die Definition von Sprachbewusstheit die unterschiedlichen Module der Sprache (Phonetik/Phonologie, Lexikon, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik…) in vergleichbarem Maße abdeckt und ob je nach Modul die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen.
Das Ergebnis wiederum ist von großer unterrichtspraktischer Bedeutung, zeigt es doch, dass die alltagssprachlich unterschiedlichen Gruppen der Schülerinnen und Schüler in sehr verschiedenem Ausmaß von sprachenintegrativem Unterricht profitieren, und dass hierbei die Verhältnisse andere sind, als bisher angenommen wurde: Einsprachige Kinder profitieren besonders stark und gleichen den Rückstand zu den mehrsprachigen Kindern aus.
Sprachenintegrativer Deutschunterricht in der Grundschule ist demnach vor allem eine Fördermöglichkeit für einsprachige Kinder in einer für den Aufbau von Sprachbewusstheit wesentlichen Lebensphase.
Schulentwicklung NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Sie haben Fragen oder Anregungen?