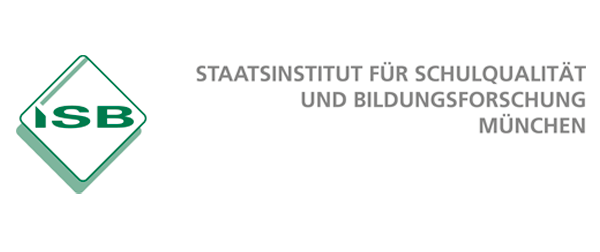Fragestellungen der Studie:
- Worauf ist beim kooperativen Verschriftlichen von naturwissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen zu achten, damit Sprach- und Konzeptbildung gefördert werden?
Rezension zur Studie
Bleiker, J. & Obendrauf, M. (2023). „Wenn man es aufschreibt, muss es richtig sein!“ – Kooperatives Verschriftlichen im naturwissenschaftlichen Unterricht als Möglichkeit, sprachliches und fachliches Lernen zu verbinden – und zu untersuchen. Zeitschrift für Grundschulforschung 16, 75-94.FIS BildungIm naturwissenschaftlichen Unterricht kann der Verschriftlichung von Untersuchungsbefunden neben der Dokumentation und Ergebnissicherung auch die Bedeutung zukommen, sprach- und konzeptbildend zu wirken. Während kognitionspsychologische Überlegungen hierzu eindeutige Ergebnisse erwarten lassen, zeigen die empirischen Befunde bislang nur schwache Zusammenhänge und sind in Teilen widersprüchlich. Bleiker und Obendrauf untersuchen in ihrer Studie am Beispiel einer Unterrichtssequenz im Primarbereich unter Einbezug soziokultureller/situationeller Faktoren die Frage, in welcher Weise sich solche angenommenen Bezüge zwischen sprachlichem und fachlichem (hier: naturwissenschaftlichem) Lernen empirisch rekonstruieren lassen.
Dies geschieht durch eine qualitativ ausgerichtete Interpretation von Video- und Tonaufzeichnungen authentischer Schulstunden im naturwissenschaftlichen Unterricht von Schulen der Schweiz, in denen Kinder in Partnerarbeit Versuchsergebnisse auf kooperativer Basis verschriftlichen sollten. Aus den in dieser Partnerarbeit geführten inhalts- und sprachbezogenen Diskussionen schließen Bleiker und Obendrauf auf konzeptionelle und sprachliche Entwicklungen (im Hinblick auf Bildungssprache). Sie identifizieren vier unterschiedliche Arbeitsmodi in den Teams, welche jeweils verschiedene Fortschritte bei der Sprach- und Konzeptentwicklung zulassen oder behindern. Daraus leiten die Forschenden Konsequenzen für den Unterricht ab.
In dieser Arbeit wird Evidenz dafür geliefert, dass sprachliches und fachliches Lernen im Rahmen kooperativer Verschriftlichung gelingen kann. Zudem weist sie durch den Nachweis unterschiedlicher Arbeitsmodi unmittelbare unterrichtspraktische Bedeutung auf. Darüber hinaus wird dazu angeregt, diese Untersuchung auf andere Fachgruppen und Alterskohorten auszudehnen und dabei stärker sprachliche Voraussetzungen der Kinder zu thematisieren. Beeinträchtigt wird die Studie dadurch, dass die Datenmenge, auf der die Untersuchung beruht, nicht transparent dargelegt wird. Offen bleibt ebenfalls, ob die beobachteten Fortschritte bei allen Gruppenmitgliedern auftreten, welche Rolle motivationalen Faktoren und dem Grad der Differenzierung (Gleichschrittigkeit vs. Binnendifferenzierung) zukommt und wie die qualitativ gewonnenen Befunde unabhängig abzusichern sind.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Welche Rolle nimmt in meinem Unterricht kooperative Verschriftlichung ein? In welchen Unterrichtssituationen setze ich sie (sinnvoll) ein?
- Welche Erfahrungen habe ich dabei im Hinblick auf die Entwicklung inhaltlicher Konzepte gemacht? Habe ich auch eine Entwicklung von Bildungssprache feststellen können? Welche Kinder profitieren mehr, welche weniger von dieser Form von Teamarbeit? Gibt es Kinder, für die andere Unterrichtsformen geeigneter sind?
- Welche Beobachtungen habe ich zu den sozialen Aspekten kooperativen Arbeitens gemacht: Welche Rolle spielen Motivationslage, Wissensunterschiede, zwischenmenschliche Beziehungen, alltagssprachlicher Hintergrund usw. für das Gelingen kooperativer Teamarbeit? Welche Strategien habe ich diesbezüglich, um ein Gelingen der Teamarbeit abzusichern?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Inwiefern wird Sprachbildung als selbstverständlicher Fokus im Fachunterricht in der Schule berücksichtigt? Wird an Ihrer Schule Platz dafür geschaffen? Wird Sprachbildung im Fachunterricht gezielt avisiert?
- Inwiefern wird in der Schule eine „Durchgängige Sprachbildung“ in allen Fächern berücksichtigt oder gar von Ihnen als Schulleitung erwartet?
- Wie werden die Lehrkräfte an Ihrer Schule darin unterstützt, ihren Fachunterricht auch sprachsensibel zu gestalten? Welche Grundlagen sind in schulinternen Stoffverteilungsplänen hierfür gelegt? Auf welche Materialien können Lehrkräfte zurückgreifen?
- Inwiefern wird auf durch die Schulleitung initiierten Fortbildungen der Schwerpunkt auf den Zusammenhang zwischen Fach- und Sprachlernen gelegt, indem z. B. die Bereicherung des Fachunterrichts durch Methoden wie der kooperativen Verschriftlichung fokussiert wird?
Beim naturwissenschaftlichen Unterricht in der (Schweizer) Primarschulstufe folgt häufig auf eine Phase des Experiments eine Phase, in der Beobachtungen und Ergebnisse verschriftlicht werden: Konkretes Handeln wird auf diesem Weg in schriftliche (oder bildliche) Repräsentationsformen umgesetzt. Oft wird erst bei diesem Schritt für die Lehrkräfte oder die Kinder deutlich, wo noch inhaltlicher und/oder sprachlicher Klärungsbedarf besteht.
Da Bleiker und Obendrauf – hierin Wellington et al. (2001) folgend – von einer nicht aufzulösenden Verzahnung von fachlichem und sprachlichem Wissen ausgehen, stellen sie die Frage, inwiefern sich solche Bezüge zwischen sprachlichem und fachlichem Lernen auf empirischer Basis nachvollziehen lassen.
Nach den bislang im deutschsprachigen Bereich durchgeführten Studien diene die Verschriftlichung im naturwissenschaftlichen Unterricht vor allem der Dokumentation und Konservation von Wissen und weniger dem Erkenntnisgewinn. Kognitionspsychologisch orientierte Überlegungen legten jedoch nahe, dass Syntax und Semantik die Lernenden dabei unterstützen, zu zuvor impliziten Konzepten Zugang zu gewinnen. Lernende müssten beim Schreiben Strategien wie „Wichtiges auswählen“, „Gedanken strukturieren“ durchführen, welche das Lernen unterstützen sollen. Zudem könne Schreiben geistige Handlungen wie Strukturieren, Elaborieren oder Transformieren provozieren, welche die Speicherung im Langzeitgedächtnis verbessern. Allerdings müsse der Schreibauftrag hierfür über das bloße Notieren von Wörtern oder Merksätzen hinausgehen und unter schreibdidaktischer Perspektive instruiert werden.
Gemessen an diesen theoretisch ableitbaren Erwartungen sind die Ergebnisse von Studien zur Frage, inwiefern Schreiben das Lernen verbessert, bislang sehr uneinheitlich: Sie gehen nur mit geringen Effektstärken einher und zeigen sogar gelegentlich negative Effekte. Bleiker und Obendrauf vermuten, dass die bisherigen Arbeiten zu stark kognitionspsychologisch orientiert gewesen seien und die sozio-kulturellen Gegebenheiten vernachlässigt worden seien: Ziele, Werte, Identitäten, Überzeugungen, Erwartungen der Lernenden könnten einen Einfluss haben und sollten daher in ihrer eigenen Arbeit berücksichtigt werden.
Darüber hinaus sei zu erwarten, dass das Ausmaß von Sprach- und Schreibkompetenzen der Lernenden einen Einfluss auf fachliches Lernen habe. Geringe Schreibfähigkeiten erschwerten ihre Nutzung in der Lernphase zur Strukturierung von Wissen. Für Lehrkräfte sei es ebenfalls schwieriger, zu erkennen, ob Schülerinnen und Schüler mit geringeren sprachlichen Fähigkeiten über konzeptuelles Verständnis verfügten, sodass hierdurch mögliche Einflüsse von Sprach- und Schreibkompetenz auf das Lernen erklärt werden könnten. Entgegengesetzt werde aus der schreibdidaktischen Perspektive angeführt, dass insbesondere der naturwissenschaftliche Unterricht ein großes Potenzial für den Ausbau literaler Kompetenzen biete. Aus diesen Gründen bedürfe es einer Berücksichtigung dieser Kompetenzen in künftigen Arbeiten.
Hinsichtlich der Schreibform untersuchen Bleiker und Obendrauf kooperativ-konversationelles Schreiben: Lernende erarbeiten in einer Face-to-face-Situation einen Text. Für die Auswahl dieser Schreibform führen sie drei Aspekte an:
- Naturwissenschaftsdidaktik: Der Aufbau tragfähiger sachlich-fachlicher Konzepte findet unter anderem in unterrichtlichen Interaktionen statt.
- Schreibdidaktik: Kooperatives Schreiben kann die Brücke dafür bilden, dass auf dem Umweg über gemeinsame Arbeit auch die individuellen Schreibkompetenzen gesteigert werden.
- Forschungsmethodik: Die Kinder müssen ihre Vorstellungen versprachlichen und können deshalb dabei beobachtet werden, wie sie fachliche Konzepte entwickeln.
Stichprobe
Die Datenbasis bildeten Videoaufnahmen von authentischen Schulstunden der 3. bis 5. Primarklasse Schweizer Schulen. Für die Untersuchung wurden die Klassen danach ausgewählt, dass sie ein breites Spektrum im Bereich „sprachliche Homogenität/Heterogenität“ abdecken. Insgesamt lagen Aufnahmen im Umfang von ca. 50 Zeitstunden vor. Die Videoaufnahmen stammten aus dem Projekt „‚… und was schreiben wir jetzt auf?‘ – Empirische Studie zu Sprache und Sprachhandeln an der Schnittstelle von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Schulalltag“, welches von November 2018 bis Oktober 2020 durch die Pädagogische Hochschule Zürich durchgeführt wurde. Bleiker und Obendrauf analysierten für diese Untersuchung eine Unterrichtssequenz zum Thema „Muskeln“ von der Einführung bis zur abschließenden schriftlichen Prüfung.
Die Stichprobe wurde in folgendem situativen Kontext gewonnen:
In einem Stuhlkreis war den Kindern das Thema genannt worden, ein Arbeitsblatt wurde ausgeteilt, gemeinsam gelesen und besprochen. Die im Arbeitsblatt genannten Körperbewegungen (Beugen und Strecken des Beins) wurden ausprobiert, mit Fachbegriffen benannt und mithilfe eines Gummibandes durch die Lehrkraft demonstriert. Dann wurde eine analog zu bearbeitende Schreibanweisung zum Arbeitsblatt gegeben. Nach der Arbeitsphase stellten mehrere Gruppen ihre Ergebnisse vor, die Lehrkraft besprach fehlerhafte und vage Konzepte und hob eine vorbildliche Lösung hervor, sodass die Kinder diese Musterlösung in ihrem Arbeitsblatt ergänzen konnten.
Erhebungsinstrumente
Drei Kameras zeichneten das Geschehen im Klassenraum auf, alle Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler waren mit Aufnahmegeräten ausgestattet. So konnten durch Kombination von Bild- und Tonquellen von allen Arbeitsgruppen Videoclips erstellt werden. Zusätzlich wurden die schriftlichen Produkte der Kinder aus den Arbeitsphasen sowie die abschließende schriftliche Prüfung für die Analysen herangezogen.
Auswertung
Von den 20 Lektionen, in denen kooperatives Schreiben stattfand, wurden detaillierte Gesprächsinventare erstellt und die Phasen mit kooperativem Schreiben wurden auf der Basis von GAT2 transkribiert. Anschließend analysierte das Autorenteam gemeinsam Videos, Transkripte und schriftliche Produkte der Kinder.
Der methodische Zugang war interdisziplinär ausgerichtet (Naturwissenschaftsdidaktik – Deutschdidaktik), die Analyse erfolgte explorativ-qualitativ. Die induktive Analyse erstreckte sich über die gesamte Unterrichtssequenz, beginnend mit der Einführung in das Thema und endend mit der Abschlussprüfung. Den Hauptanalysefokus bildeten die konversationellen Schreibinteraktionen in Zweiergruppen.
Bezüge zwischen sprachlichem und fachbezogenem Lernen
Bleiker und Obendrauf extrahieren aus ihren Beobachtungen vier unterschiedliche Modi kooperativen Schreibens, die nicht auf Persönlichkeitsmerkmale der Kinder zurückzuführen sind, sondern je nach den jeweiligen Partnerkonstellationen, Aufgabeninhalt, dem Zeitbudget usw. in den Schreibsituationen entstehen.
- Modus „schon-wissend“: Die Kinder äußern, die Antwort schon zu kennen. Dann diskutieren sie keine inhaltlichen Aspekte, sondern wägen direkt Formulierungs- oder orthographische Varianten gegeneinander ab. So kann es etwa zu einem Übergang von einer eher alltagssprachlichen zu einer eher bildungssprachlichen Formulierung kommen, das heißt der Lernfortschritt betrifft vor allem die sprachliche Ebene.
- Modus „antagonistisch“: Hierbei wollen sich beide Kinder jeweils im Hinblick auf ihre (sehr unterschiedlichen) Auffassungen von Arbeitsweise, Inhalten und Formulierungen unnachgiebig durchsetzen. In dieser Situation kommt es weder zu nennenswertem konzeptionell-inhaltlichen, noch zu sprachlichem Lernen.
- Modus „nicht-diskutierend“: Auch bei erkennbaren inhaltlichen Differenzen diskutieren die Kinder nicht, sondern die Sätze jedes Kindes werden unverändert und unbesprochen notiert. Auch in diesem Setting wird weder konzeptionell-inhaltliches, noch sprachliches Lernen erkennbar.
- Modus „konstruierend-reflektierend“: Die Kinder starten nach einer kurzen Reflexionsphase den Versuch und bemühen sich parallel um Verschriftlichung. Bei Zweifeln wiederholen sie den Versuch oder holen Unterstützung bei der Lehrkraft ein. Hierbei zeigen die Videos sowohl sprachliche (Präzision, Verdichtung, Abstraktion) als auch konzeptionelle Fortentwicklungen. Die Fortentwicklungen finden innerhalb der Gruppe auch bei asymmetrischen Konstellationen statt, etwa wenn ein Kind deutlich besser Deutsch versteht und spricht als das andere. Der konstruierend-reflektierende Modus ist sehr zeitaufwändig; für Versuchsdurchführung und Verschriftlichung werden gleichermaßen viel Zeit genutzt. Bei den Modi „schon-wissend“ und „antagonistisch“ hingegen folgt auf eine kurze Versuchsphase eine lange Phase der Verschriftlichung. Bedingt durch den hohen Zeitaufwand beim „konstruierend-reflektierenden“ Modus werden orthographische Fragen hierbei häufig hintenangestellt bzw. unterbleiben.
Neben der Identifikation der vier Modi kooperativen Schreibens in der Arbeitsphase sehen Bleiker und Obendrauf weitere Anknüpfungspunkte für eine sprachliche Reflexion im abschließenden Unterrichtsgespräch. Hier kann die Lehrkraft das fachliche und sprachliche Lernen begleitend unterstützen. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass beim Gebrauch von Analogien (in diesem Fall zwischen Muskel und Gummiband) Probleme bei der Konzeptbildung entstehen können, sofern die Analogie nicht sorgfältig fachdidaktisch ausgewählt und dadurch möglichen sprachlichen Fallstricken vorgebeugt wurde. Die Zusammenfassung der Befunde ergibt:
- Vor allem der konstruierend-reflektierende Arbeitsmodus scheint für sprachliches und fachliches Lernen geeignet.
- Kooperative Verschriftlichung kann eine Sprachentwicklung von Alltagssprache in Richtung einer Bildungssprache begünstigen.
- Der Einsatz von Modellen und Analogien muss sorgsam vor dem fachlichen Hintergrund erwogen werden.
Methodik
Bleiker und Obendrauf mahnen in Bezug auf die Analyse des Unterrichtsgeschehens eine interdisziplinäre Herangehensweise, einen genauen Blick auf das konkrete Unterrichtsgeschehen und ein umfassendes Korpus an Informationen zum Unterricht an. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass mit Hilfe der von ihnen gewählten Methode nur eine stark begrenzte Anzahl von Unterrichtsstunden analysiert werden kann und die erzielten Befunde möglicherweise nur eingeschränkt generalisierbar sind.
Implikationen für den Unterricht
Bleiker und Obendrauf gehen davon aus, dass kooperatives Schreiben im konstruierend-reflektierenden Modus die konzeptionell-inhaltliche und die bildungssprachliche Entwicklung im naturwissenschaftlichen Unterricht voranbringen kann. Dazu muss allerdings die Aufgabe ausreichend kognitiv herausfordernd sein, um zu verhindern, dass der „schon-wissende“ Arbeitsmodus auftritt. Auch sollten Kinder in einer Gruppe arbeiten, die sich gut verstehen, um den „antagonistischen“ Arbeitsmodus zu verhindern. Schließlich muss den Kindern ausreichend Zeit eingeräumt werden, um inhaltliche und sprachliche Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls revidieren zu können.
Bleiker und Obendrauf fokussieren in ihrer Studie ein für die schulbezogene Naturwissenschaftsdidaktik sehr bedeutendes Thema: die Identifikation von Bezügen zwischen (bildungs-) sprachlichem und fachlichem Lernen im frühen naturwissenschaftlichen Unterricht im Rahmen kooperativer Verschriftlichung. Dazu schaffen Sie ein Unterrichtssetting, durch dessen Beobachtung per Video und Tonspuren wesentliche Erkenntnisse zu erzielen sind: So arbeiten sie Modi im kooperativen Unterricht heraus, die sich mit jeweils unterschiedlich starken Fortschritten im sprachlichen und fachlichen Bereich verbinden lassen.
Dabei erweist es sich als ausgesprochen günstig, dass sie konsequent qualitativ vorgehen und das beobachtete Unterrichtsgeschehen im Hinblick auf ihre Fragestellung interpretieren. Die dabei bestehende Möglichkeit der Fehlinterpretation minimieren sie, indem sie ihrerseits als interdisziplinäres (hier: Deutschdidaktik und Naturwissenschaftsdidaktik) Team arbeiten. Durch die konsequent qualitative Untersuchung nehmen sie eine Position ein, die derjenigen einer Lehrkraft nahekommt: Diese ist im Rahmen des Unterrichts ebenfalls weitgehend auf Verhaltensbeobachtungen und deren Deutung angewiesen.
Die Ergebnisse von Bleiker und Obendrauf werden dadurch im professionellen Alltagserleben der Lehrkraft nachvollziehbar und überprüfbar. Nichtsdestotrotz ergeben sich auch zu dieser Studie, ihren Ergebnissen und den daraus abgeleiteten Forderungen Einwände:
So ist nicht klar, auf welche Datenmenge sich die Studie stützt. Die Gesamtmenge der Aufzeichnungen im Rahmen des übergeordneten Projekts umfasst ca. 50 Stunden. Bei 20 Lektionen kam es zu kooperativem Schreiben, die in der Veröffentlichung genannte Rekonstruktion der Arbeitsmodi beruht offenbar auf neun Teams von Schülerinnen oder Schülern (mit jeweils zwei Personen) in einer Lehreinheit, was einer Schulstunde in einer Klasse entspräche.
Auch wird nicht klar erkennbar, ob der beobachtete Lernfortschritt bei beiden Lernenden der Zweiergruppe stattfand: So bleibt offen, ob die sprachliche und inhaltliche Weiterentwicklung von beiden Kindern (Teampartnern) vorangetrieben wird oder ob – so ein gängiges (Vor-)Urteil über Teamarbeit im Allgemeinen – vor allem leistungsstarke und hochmotivierte Lernende die Arbeit voranbringen, während leistungsschwächere und gering motivierte Lernende weniger profitieren bzw. sich auf der Leistung ihres Partnerkindes „ausruhen“ können. Es wäre also zu prüfen, ob wirklich alle Kinder von der kooperativen Verschriftlichung profitieren und ob unterschiedliche Motivationslevel Arbeitsmodus und Lernfortschritt beeinflussen.
Generell könnte es problematisch sein, dass der Lernfortschritt der Kinder nicht unabhängig von den Eindrücken von Bleiker und Obendrauf festgestellt wurde. Hier zeigt sich eine methodische Schwäche in Bezug auf das Einhalten von Gütekriterien, die in zukünftigen Studien berücksichtigt werden sollten.
Bleiker und Obendrauf ziehen den Schluss, dass kooperatives Schreiben im konstruierend-reflektierenden Modus die konzeptionell-inhaltliche Entwicklung und die bildungssprachliche Entwicklung im naturwissenschaftlichen Unterricht voranbringen kann. Dazu muss die Aufgabe allerdings ausreichend kognitiv herausfordernd sein, um zu verhindern, dass der „schon-wissende“ Arbeitsmodus auftritt. Auch sollten Kinder, die sich gut verstehen, in einer Gruppe arbeiten, um den „antagonistischen“ Arbeitsmodus zu verhindern. Schließlich muss den Kindern ausreichend Zeit eingeräumt werden, um inhaltliche und sprachliche Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls revidieren zu können.
Die aus den unterschiedlichen Arbeitsmodi abgeleiteten Konsequenzen für den Unterricht sind teilweise kritisch zu sehen. Der Aussage, dass möglichst Bedingungen geschaffen werden sollten, in denen der „konstruierend-reflektierende“ Modus herzustellen ist, ist inhaltlich voll zuzustimmen. Problematischer wird es bezüglich des „schon-wissenden“ und des „antagonistischen“ Modus. Um einen „antagonistischen“ Modus möglichst ausschließen zu können, muss die Lehrkraft das Beziehungsgefüge in einer Klasse weitgehend durchschauen, was zumindest bei Klassen, die eine Lehrkraft neu übernimmt, erst nach längerer Unterrichtserfahrung in diesen Klassen möglich sein dürfte.
Ebenso birgt die Forderung, durch Stellen einer kognitiv herausfordernden Aufgabe einen „schon-wissenden“ Arbeitsmodus zu unterbinden, eine Reihe von Problemen. Dabei spielt eine Rolle, wie heterogen eine Klasse in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit zusammengesetzt ist: Je heterogener eine Klasse ist, desto schwerer dürfte es fallen, dieser Forderung gerecht zu werden – zumindest dann, wenn neben der Unterforderung auch eine Überforderung vermieden werden soll. Dies gilt zumindest dann, wenn – wie in dem von Bleiker und Obendrauf geschaffenen Setting – gleichschrittiger Unterricht erfolgt, das heißt alle lernen zum selben Zeitpunkt dasselbe. Strebt man demgegenüber einen binnendifferenzierten Unterricht an, dann kann es schwierig werden, ähnlich leistungsstarke/motivierte/einander schätzende Teammitglieder zusammenzubringen.
Trotz dieser Einwände stellt die Arbeit von Bleiker und Obendrauf. eine gute Basis dar, um bei der Frage, in welcher Weise Bezüge zwischen sprachlichem und fachbezogenem Lernen durch kooperative Verschriftlichung zu erzielen sind, voranzukommen. Weitere Forschungen zu diesem Themenkomplex erscheinen dringend geboten. So wäre etwa an eine Anpassung der Untersuchung, auch an Fächer abseits der Naturwissenschaften und an unterschiedliche Alterskohorten, zu denken. Im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Bildungssprache und die Verbindung von sprachlicher und konzeptueller Entwicklung untersucht werden, sollte im Rahmen zukünftiger Forschungen auch stärker berücksichtigt werden, dass in vielen Klassen eine bunte Mischung von Kindern mit vollkommen unterschiedlichen Alltags- und Familiensprachen besteht.
Schulentwicklung NRW
Schulentwicklung NRW
Aus der Reihe "Beiträge zur Schulentwicklung"
Sie haben Fragen oder Anregungen?
 Mathematik und Naturwissenschaften weiterdenken
Mathematik und Naturwissenschaften weiterdenken