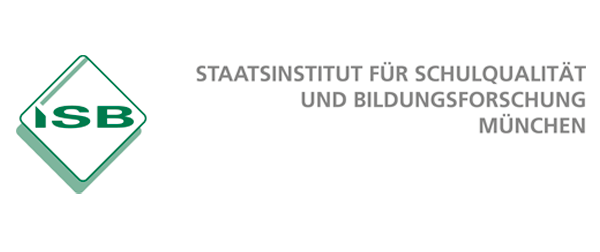Fragestellungen der Studie:
- Lassen sich Freundschaften durch Nebeneinandersetzen fördern?
Rezension zur Studie
Rohrer, J. M., Keller, T. & Elwert, F. (2021). Proximity can induce diverse friendships: A large randomized classroom experiment. PLoS ONE 16(8): e0255097, 1–15.Freundschaften sind eine wichtige Ressource für persönliche Entwicklung. Zwar befreunden sich eher Personen, die einander ähnlich sind (Homophilie), aber auch räumliche Nähe hat sich für die Entstehung von Freundschaften als relevant erwiesen.
Rohrer, Keller und Elwert untersuchen daher, ob die Sitzordnung in der Klasse einen Einfluss auf Freundschaften innerhalb der Lerngruppe hat und welche Rolle dabei spielt, wie ähnlich sich die Schülerinnen und Schüler sind.
Dazu wurden 2 996 ungarische Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3 bis 8 zu ihren Freundschaften innerhalb ihrer Klasse befragt, nachdem sie ein Halbjahr lang neben einer zufällig bestimmten Mitschülerin beziehungsweise neben einem zufällig bestimmten Mitschüler gesessen hatten. Als Freundschaft wurde gewertet, wenn zwei Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig als befreundet benannten. Zur Bestimmung der Ähnlichkeit (Homogenität bzw. Heterogenität) wurde für die Schülerpaare ein Kennwert berechnet, in den das Geschlecht, schulische Leistungen und die ethnische Zugehörigkeit (Roma oder Nicht-Roma) einflossen. Anschließend wurde ermittelt, ob Freundschaften eher zwischen sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern bestehen und inwiefern dieser Effekt durch die Ähnlichkeit der Sitznachbarschaft modifiziert wird. Die Auswertungen erfolgten mithilfe von Probit-Modellen und durchschnittlichen marginalen Effekten (AME), die auf Grundlage der Bayes-Statistik berechnet wurden.
Im Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit einer gegenseitigen Freundschaftsbenennung bei sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern im Durchschnitt um 7 Prozentpunkte höher (15 % vs. 22 %), wobei die entsprechenden Werte bei heterogenen Schülerpaaren deutlich niedriger sind und der Effekt des Nebeneinandersitzens geringer ausfällt. Bei differenzierter Betrachtung der Ähnlichkeitsdimensionen sind nur für das Geschlecht Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit für Freundschaften sicher nachweisbar (gleichgeschlechtliche Paare sind eher befreundet als gemischtgeschlechtliche Paare).
Änderungen der Sitzordnung können demnach die sozialen Beziehungen innerhalb von Lerngruppen beeinflussen, allerdings dominiert dabei das Prinzip der Homophilie und Freundschaften zwischen unähnlichen Schülerpaaren, die pädagogisch besonders vorteilhaft erscheinen, werden allein durch das Nebeneinandersitzen kaum gefördert.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Inwiefern gestalte ich die Sitzordnung in meinen Klassen auf Grundlage von pädagogischen Überlegungen?
- Inwiefern gibt es in meinen Klassen Freundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern, die sich im Hinblick auf das Geschlecht, die schulischen Leistungen und die ethnische Zugehörigkeit unterscheiden?
- Was kann ich tun, um die Entstehung von heterogenen Freundschaften in meinen Klassen zu fördern?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Inwieweit wird die (Rolle der) Sitzordnung in meiner Schule als pädagogisches Instrument genutzt und in ihrer Wirkung reflektiert?
- In welchen Austauschrunden können die Sitzordnung, ihr Einfluss auf Freundschaften sowie unsere Möglichkeiten als Schule beim Abbau sozialer Barrieren thematisiert werden?
- Was benötigen meine Lehrkräfte, um die Sitzordnung nach pädagogischen Gesichtspunkten zu gestalten und die Entwicklung von heterogenen Freundschaften zu fördern?
Rohrer et al. führen zu Beginn ihres Artikels aus, wie wichtig Freundschaften für Individuen sind, da sie deren Lebensumstände in vielen Bereichen wie z. B. Gesundheit, beruflicher Werdegang oder Kriminalität beeinflussen. Dabei zeige sich, dass Freundschaften bevorzugt zwischen Personen geschlossen werden, die sich in Bezug auf bestimmte Merkmale gleichen wie z. B. in ihrem Geschlecht, ihrer Bildung oder ihrer ethnischen Herkunft. Die Folgen seien ein Mangel an Heterogenität in sozialen Gefügen und ein ungleich verteiltes Profitieren von sozialen Netzwerken.
Studien an amerikanischen Colleges hätten gezeigt, dass räumliche Nähe – als Sitzbenachbarte im Klassenraum oder als Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Studentenwohnheim – dazu führt, dass Freundschaften auch in heterogenen Paaren geschlossen werden (vgl. Baker, Mayer & Puller, 2011; Camargo, Stinebrickner & Stinebrickner, 2010).
Die vorliegende Studie schließt an diese Ergebnisse an, versucht aber gleichzeitig, zwei Forschungslücken zu schließen. Zum einen werden Schülerinnen und Schüler und nicht Studierende in den Fokus genommen und zum anderen wird der Einfluss der Heterogenität nicht nur für die Kategorie ethnische Zugehörigkeit, sondern zusätzlich für die Kategorien schulische Leistungen und Geschlecht untersucht.
Konkret wird in der Untersuchung den Schülerinnen und Schülern ein Sitznachbar bzw. eine Sitznachbarin per Zufall zugelost, um zum einen die Annahme zu prüfen, dass eine von außen erzwungene räumliche Nähe Freundschaften fördert („Sitznachbar-Hypothese“). Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Nebeneinandersitzen sowohl die Neubildung von Freundschaften unterstützen kann als auch das Anhalten einer bestehenden Freundschaft potenziell fördert, was insgesamt als „Tischgenosseneffekt“ bezeichnet wird.
Zum anderen wird eine „Veränderung-durch-Ähnlichkeit-Hypothese“ getestet und untersucht, ob der Effekt, dass eine Sitznachbarschaft die Bildung von Freundschaften fördert, stärker ausfällt, wenn die Nebeneinandersitzenden sich in Bezug auf die Kategorien Geschlecht, schulische Leistungen und ethnische Zugehörigkeit ähnlicher sind.
Stichprobe und Durchführung
Die verwendeten Daten entstammen einem Feldexperiment im Schuljahr 2017/2018. Dabei wurde an 40 Schulen im ländlichen Raum in Ungarn in 182 Klassen der Jahrgangsstufen 3 und 8 die Sitzordnung für fünf Monate im Winterhalbjahr nach dem Zufallsprinzip festgelegt und (mindestens) in den Hauptfächern Mathematik, ungarische Literatur und ungarische Grammatik realisiert.
Die 2 996 Schülerinnen und Schüler, die an der Untersuchung teilnahmen, verbrachten 25 % bis 45 % der Unterrichtszeit neben ihrem Tischnachbarn/ihrer Tischnachbarin, der/die ihnen durch einen Algorithmus zugelost worden war. Die Stichprobe bestand zu 48 % aus Schülerinnen und zu 22 % aus Kindern der Ethnie Roma.
Im darauffolgenden Frühjahr nahmen die Probandinnen und Probanden an einer 45-minütigen schriftlichen Befragung teil, in der sie u. a. ihre fünf besten Freundinnen und Freunde in der Klasse benennen sollten. Wenn beide Mitglieder einer Sitznachbarschaft sich gegenseitig benannten, wurde dies als manifeste reziproke Freundschaft gewertet.
Auswertung
Für die Auswertungen wurde eine Regressionsgleichung formuliert, mit der die Freundschaftsneigung als nicht direkt beobachtbares (latentes) und kontinuierliches Merkmal geschätzt wurde, um zu prüfen, ob Sitznachbarschaft und Ähnlichkeit sich als Einflussfaktoren der Freundschaftsneigung nachweisen lassen (Probit-Modell). Passend zur hierarchischen Datenstruktur, bei der Schülerinnen und Schüler in Sitznachbarschaften und diese in Klassen geschachtelt sind, erfolgte die Schätzung auf Grundlage der Bayes-Statistik und es wurden Intervalle berechnet, in denen die wahren Parameterwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegen (Credible Interval, CI95).
Bei non-linearen Modellen können die Regressionskoeffizienten nur dahingehend interpretiert werden, ob sie hinreichend sicher von Null verschieden sind, was immer dann zutrifft, wenn die Null nicht im berechneten 95 %-Intervall enthalten ist, zum Beispiel CI95: [0.5, 2]. Daher wurde die Größe des Einflusses anhand von durchschnittlichen marginalen Effekten (AME) berechnet und untersucht, wie sich die Wahrscheinlichkeiten für eine gegenseitige Freundschaftsbenennung in der Gruppe mit großer Ähnlichkeit (+1 SD) von der Gruppe mit mittlerer und mit geringer Ähnlichkeit (-1 SD) unterscheiden.
Zur Bestimmung der Ähnlichkeit wurde für jedes Schülerpaar (Dyade) in der jeweiligen Klasse eine Kennzahl berechnet (Gower-Koeffizient). Hierbei wurden berücksichtigt: Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und schulische Leistungen (Noten in den Hauptfächern sowie Bewertungen für Verhalten und Fleiß). Bei der Berechnung eines Gower-Koeffizienten können sowohl qualitative als auch quantitative Daten einfließen, so dass jedes Merkmal einen standardisierten Beitrag zur Gesamtähnlichkeit leistet. Der resultierende Wert für die Gesamtähnlichkeit liegt zwischen 0 (maximale Unähnlichkeit) und 1 (maximale Ähnlichkeit).
Um den allgemeinen Effekt von Ähnlichkeit auf Freundschaften von sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern zu untersuchen, wurde zunächst der Gower-Koeffizient als Einflussfaktor in die Regressionsgleichung aufgenommen. In weiteren Analysen wurden die Effekte von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und schulischer Leistung separat in den Blick genommen, um herauszufinden, inwiefern sie für sich genommen den Effekt des Nebeneinandersitzens modifizieren.
Schließlich wurden verschiedene Robustheitschecks durchgeführt, indem z. B. auch nicht-reziproke (nur einseitig erklärte) Freundschaften in die Berechnungen einbezogen wurden. Die resultierenden Abweichungen von den ursprünglich gewonnenen Ergebnissen erwiesen sich als gering, weshalb Rohrer et al. zu der Einschätzung gelangen, dass ihre qualitativen Schlussfolgerungen dadurch nicht in Frage gestellt werden.
Etwa 10 % der Schülerinnen und Schüler wurden aus den zentralen Analysen ausgeschlossen, weil sie niemanden als Freund oder Freundin benannt hatten bzw. die entsprechende Angabe fehlte. Da Freundschaftsbenennungen bei Schülerinnen und Schülern mit schwächeren Schulleistungen und höheren Ähnlichkeitswerten tendenziell häufiger fehlten, wurden zusätzlich alternative Analysen mit systematisch vervollständigten Datensätzen berechnet.
Für die Vervollständigung der fehlenden Werte wurden konservative Annahmen getroffen, um eine untere Grenze (lower bound) des Effekts des Nebeneinandersitzens zu bestimmen. Diese Annahmen bestanden darin, dass alle Schülerinnen und Schüler mit fehlenden Angaben zum einen ihren Sitznachbarn bzw. ihre Sitznachbarin nicht als befreundet benannt hätten und zum anderen alle diejenigen Schülerinnen und Schüler als befreundet benennen würden, die sie ihrerseits als befreundet benannt hatten.
Sitznachbar-Hypothese
Das Nebeneinandersitzen hat einen positiven Effekt auf Freundschaften unter den Schülerinnen und Schülern. Dies zeigt sich zum einen durch eine höhere Freundschaftsneigung (bDeskmate = 0.27, CI95: [0.19; 0.35]); zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit einer gegenseitigen Freundschaftsbenennung bei sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern um 7 Prozentpunkte größer als bei Schülerinnen und Schülern, die nicht nebeneinandersitzen (15 % vs. 22 %). Als untere Grenze des Effekts werden 4 Prozentpunkte ermittelt (15 % vs. 19 %). Die Befunde bleiben stabil, auch wenn die alternativen Analysen mit konservativen Annahmen berechnet werden (siehe Abschnitt Design).
Veränderung-durch-Ähnlichkeit-Hypothese
Wie erwartet, lässt sich, unabhängig von der Sitzordnung, ein deutlicher Effekt der Ähnlichkeit auf die Freundschaftsneigung erkennen (bSimilarity = 0.83, CI95: [0.80, 0.86]). Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft bei großer Ähnlichkeit um 20 Prozentpunkte (CI95: [19.4, 21.4]) höher als bei mittlerer Ähnlichkeit, wobei die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft bei mittlerer Ähnlichkeit ihrerseits um 9 Prozentpunkte (CI95: [8.5, 9.5]) höher ausfällt als bei geringer Ähnlichkeit.
Doch inwiefern modifiziert Ähnlichkeit den zuvor bestätigten Tischgenosseneffekt? Während sich anhand des Interaktionsterms (bSimilarity*Deskmate) kein (zusätzlicher) Effekt der mittels Gower-Koeffizient berechneten Ähnlichkeit auf die mit dem Probit-Modell geschätzte Freundschaftsneigung von sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern nachweisen lässt, liefert die Auswertung mithilfe der durchschnittlichen marginalen Effekte, welche sich auf die tatsächlich beobachteten Freundschaftsnominierungen beziehen, eine andere Erkenntnis:
Hypothesenkonform hängt die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft unter sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern von ihrer Ähnlichkeit ab, wobei die Größe dieses Effekts variiert: Bei großer Ähnlichkeit wächst die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft zwischen sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern um 11.7 Prozentpunkte (CI95: [7.7, 15.6]), was (gerundet) 6.1 Prozentpunkte (CI95: [2.6, 9.8]) mehr sind als bei mittlerer Ähnlichkeit ( 5.7 Prozentpunkte, CI95: [3.4, 8.0]), die ihrerseits mit einer 4.2 Prozentpunkte (CI95: [0.3, 5.7]) höheren Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft einher geht als eine geringe Ähnlichkeit, bei welcher der Effekt nur 1.5 Prozentpunkte beträgt (CI95: [0.2, 3.1]).
Somit erhöht das Nebeneinandersitzen die Freundschaftsneigung und die Wahrscheinlichkeit für eine gegenseitige Freundschaftsbenennung für alle Schülerinnen und Schüler, sogar für ziemlich unähnliche. Da die Freundschaftswahrscheinlichkeit bei ähnlichen Schülerpaaren jedoch grundsätzlich höher ausfällt, bewirkt das Nebeneinandersitzen von ähnlichen Schülerinnen und Schülern tendenziell mehr gegenseitige Freundschaften als bei unähnlichen Paaren. Einschränkend weisen Rohrer et al. darauf hin, dass bei den alternativen Analysen mit den konservativen Annahmen (siehe Abschnitt Design) die 95 %-Intervalle für die Unterschiede in den Freundschaftswahrscheinlichkeiten zwischen den Ähnlichkeitsgruppen (niedrig, mittel, hoch) teilweise die Null enthalten und somit als nicht hinreichend gesichert gelten können.
Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Ähnlichkeitsdimensionen zeigt sich, dass der Effekt für das Geschlecht besonders groß ist. Während sich die Wahrscheinlichkeit einer Freundschaft bei Sitznachbarn unterschiedlichen Geschlechts um 2,3 Prozentpunkte (CI95: [1.0, 3.9]) erhöht, steigert sie sich bei zwei Mädchen um 9.3 Prozentpunkte (CI95: [4.0, 14.8]) und bei zwei Jungen um 13.1 (CI95: [8.0, 18.3]).
Für die schulischen Leistungen lässt sich ein modifizierender Effekt der Ähnlichkeit nicht sicher nachweisen, die 95 %-Intervalle der Wahrscheinlichkeiten enthalten die Null, so dass möglicherweise kein Effekt besteht. Auch im Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit ergibt sich keine überzeugende Bestätigung für eine höhere Freundschaftswahrscheinlichkeit bei ethnisch homogenen Sitznachbarschaften im Vergleich zu ethnisch heterogenen Sitznachbarschaften.
Hintergrund
Freundschaften sind als soziale Netzwerke ein Teil des sozialen Kapitals und spielen eine wichtige Rolle dabei, Zugang zu Ressourcen, Informationen und Unterstützung zu erhalten (Bourdieu 1983). Zwar befreunden sich Menschen eher, wenn sie einander ähnlich sind (Homophilie), aber schon früh konnte (für studentische Wohnheime) gezeigt werden, dass auch räumliche Nähe und die damit verbundenen Interaktionsgelegenheiten die Entstehung von Freundschaften beeinflussen (Festinger, Schachter & Back, 1950).
Rohrer et al. greifen diese Befundlage auf und füllen eine Forschungslücke, indem sie untersuchen, inwiefern sich eine per Zufall festgelegte (quasi erzwungene) Sitzordnung auf die Freundschaften von Schülerinnen und Schülern auswirkt (Sitznachbar-Hypothese) und welche Rolle die Ähnlichkeit der Sitznachbarschaft im Hinblick auf Geschlecht, schulische Leistungen und ethnische Zugehörigkeit dabei spielt (Veränderung-durch-Ähnlichkeit-Hypothese).
Der Abbau von Vorurteilen, die Förderung von Toleranz und von sozialen Kompetenzen sind wichtige pädagogische Ziele. Daneben stellt die Verringerung von sozialer Ungleichheit und die Erhöhung sozialer Mobilität eine große gesellschaftliche Herausforderung dar. Insofern sind Erkenntnisse dazu, ob die Gestaltung der Sitzordnung durch ihren Einfluss auf Freundschaften hierfür einen wirksamen Ansatzpunkt bieten kann, von einiger Relevanz.
Design
Die Anlage der Studie, das entwickelte statistische Modell und die Auswertungsstrategie werden ausführlich und transparent präsentiert. Es fehlt eine detaillierte Darstellung des Fragebogens. Die Auswertungen können anhand weiterer Dokumente, die im Artikel verlinkt sind, tiefergehend nachvollzogen werden.
Leider erweisen sich die herangezogenen Daten für die Untersuchung des Einflusses der Ähnlichkeitsdimensionen als nicht optimal (etliche fehlende Angaben, geringe Varianz bei ethnischer Zugehörigkeit, zu kleiner Stichprobenumfang), sodass im Hinblick auf die Veränderung-durch-Ähnlichkeit-Hypothese die Rolle von schulischen Leistungen und ethnischer Zugehörigkeit nicht sicher geklärt werden kann. Daneben bleibt offen, was die anhand der (erzwungenen) Sitzordnung beeinflussten Freundschaften bewirken, da keine Merkmale wie schülerseitige Einstellungen oder soziale Kompetenzen erhoben wurden.
Ergebnisse
Rohrer et al. finden Bestätigung für ihre Sitznachbar-Hypothese, nach der Freundschaften durch eine von außen erzwungene räumliche Nähe gefördert werden, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft ist bei sitzbenachbarten Schülerinnen und Schülern um 7 Prozentpunkte höher. Dieser Anstieg fällt bei heterogenen Sitznachbarschaften (noch) geringer aus. Die Veränderung-durch-Ähnlichkeit-Hypothese wird eingeschränkt bestätigt: Bei zwei nebeneinandersitzenden Mädchen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft um 9 Prozentpunkte, bei zwei nebeneinandersitzenden Jungen um 13 Prozentpunkte höher als bei gemischtgeschlechtlichen Paaren. Im Hinblick auf schulische Leistungen und ethnische Zugehörigkeit ist nicht sicher nachweisbar, dass Freundschaften je nach Ähnlichkeit unterschiedlich wahrscheinlich sind.
Die Forschenden hinterfragen, ob die Ergebnisse ihrer Studie generalisierbar sind, da sie in einer ländlichen Gegend mit im Schnitt vergleichsweise niedrigen Schulleistungen und weniger gut gebildeten Eltern durchgeführt wurde. Auch die Freiwilligkeit der Teilnahme könnte dazu geführt haben, dass die einbezogenen Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf relevante Drittvariablen (Offenheit) möglicherweise nicht repräsentativ sind.
Rohrer et al. bewerten es als ermutigend, dass das von außen vorgegebene Nebeneinandersitzen die Freundschaftsneigung nicht beeinträchtigt, wenngleich die Intervention bei ähnlichen Schülerpaaren erfolgreicher ist. Als Erklärung führen sie an, dass das Nebeneinandersitzen möglicherweise bereits bestehende Freundschaften besser vor der Auflösung schütze. Alternativ wäre denkbar, dass die Schwelle, jemanden als befreundet zu benennen, aufgrund von Gruppennormen für unähnliche Schülerpaare höher liegt (z. B. „Jungs sind doof“, „Streber sind uncool“).
Die Forschenden schlussfolgern, dass sogar in Gruppen, die sich gut kennen und in denen sich bereits zuvor Freundschaften über eine längere Zeit etabliert haben, kleine Änderungen der räumlichen Nähe Freundschaften substanziell beeinflussen können. Sie merken an, dass Freundschaften zwischen jungen Schülerinnen und Schülern, die unterschiedlichen Geschlechtern, Leistungsgruppen und Ethnien zuzuordnen sind, vermutlich zu sozialen Fähigkeiten beitrügen sowie Einstellungen mit dauerhaften Konsequenzen prägten. Weiterhin sehen sie die Vermutung bestärkt, dass es möglich ist, mithilfe gezielter, kostengünstiger und breit anwendbarer Maßnahmen soziale Netzwerke umzugestalten, um positive Lebensverläufe von Schülerinnen und Schülern zu fördern, Segregation zu verringern und Beziehungen zwischen Gruppen zu verbessern.
Diese Ausführungen erscheinen angesichts der präsentierten Befunde sehr optimistisch. Der Effekt des Nebeneinandersitzens ist nicht sehr groß und die Wahrscheinlichkeit für Freundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern, die sich einander unähnlich sind, steigt durch das Nebeneinandersitzen kaum an, sondern bleibt vergleichsweise gering. Außerdem ist die Wirkung der über die (erzwungene) Sitzordnung beeinflussten Freundschaften auf pädagogisch und gesellschaftlich wünschenswerte Outcome-Variablen letztlich nicht abschätzbar und bleibt spekulativ.
Trotzdem ist die Studie gewinnbringend zu lesen und zwar zum einen, da die Bedeutung von Freundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern in den Blick genommen wird und da zum anderen darauf hingewiesen wird, dass Freundschaften nicht nur individuell wichtig sind, sondern potenziell auch für die Entwicklung einer Gesellschaft. Freundschaften könnten dabei helfen, Toleranz zu fördern und soziale Barrieren abzubauen. Zum anderen macht sie aufmerksam auf die Gestaltung der Sitzordnung und wirft ein Schlaglicht auf mögliche Effekte, die diese vergleichsweise kleine und einfach umzusetzende Maßnahme haben kann.
Schulentwicklung NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Sie haben Fragen oder Anregungen?