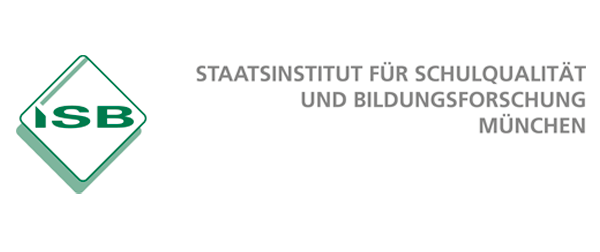Fragestellungen der Studie:
- Wie lassen sich Schülerleistungen verbessern und Bildungsungleichheiten verringern? Erträge des Förderprogramms "London Challenge".
Rezension zur Studie
Demie, F. (2023). Tackling educational inequality: Lessons from London schools. Equity in Education & Society, 2(3), 1–24.Feyisa Demie beleuchtet die Erträge des groß angelegten Projekts „London Challenge“ (2003–2011), durch das öffentliche Schulen in London gezielt gefördert wurden. Ziel war es, die Schülerleistungen an den schwächsten Schulen zu steigern, Leistungsunterschiede zu verringern und Schulqualität zu verbessern. Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse zum Sekundarschulabschluss (GCSE) analysiert sie, wie sich die Leistungen an den Londoner Schulen verändert haben. Anschließend zeigt sie auf, welche Faktoren und Strategien dem zugrunde lagen und welche Erkenntnisse sich daraus ziehen lassen. Hierfür greift die Autorin auf Befunde der Ofsted-Schulinspektion zurück, wertet Fallstudien aus und bezieht weitere Forschungsliteratur ein.
Demie weist nach, dass sich die GCSE-Prüfungsleistungen im Förderzeitraum in London überdurchschnittlich verbesserten und am Ende die landesweiten Ergebnisse übertrafen - im Gegensatz zu den anfänglichen Resultaten und sogar in Stadtgebieten mit einer sozioökonomisch eher benachteiligten Schülerschaft. Zudem konnten Angehörige ethnischer Minderheiten ihre Leistungsnachteile großteils deutlich verringern.
Einen Erfolgsfaktor sieht die Autorin in führungsstarken und anspruchsvollen Schulleitungen, die sich auf Qualitätsverbesserungen beim Lehren und Lernen, auf effektive Datennutzung und auf Verbesserung der Schülerleistungen konzentrieren. Für ausschlaggebend hält sie gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte, die hohe Leistungserwartungen haben, motivierend unterrichten, individuell fördern und hierzu untereinander kooperieren, die ihr Tun hinterfragen und anpassen. Als zentrale Erfolgsstrategie beschreibt sie die Überwachung des individuellen Lernfortschritts mit Tests, die den Lernzuwachs abbilden und zu wirksamen Interventionen für alle Schülerinnen und Schüler führen. Weitere Gelingensbedingungen sind inklusive Lehrpläne, die kulturelle, ethnische und sprachliche Vielfalt berücksichtigen, sowie eine effektive Unterstützung in Englisch als Zweitsprache, eine multi-ethnische Zusammensetzung des Schulpersonals, zusätzliche finanzielle Mittel, Hilfestellungen durch die lokalen Schulbehörden und ein Denken in langen Zeiträumen.
Die Studie liefert plausible und konkrete Hinweise auf relevante Ansatzpunkte und Bedingungen zur Förderung und Entwicklung von Schulen in sozialräumlich deprivierter Lage. Wenngleich aufgrund der Gemengelage an Förderprogrammen unklar bleibt, inwiefern die einzelnen Maßnahmen zu den besseren Prüfungsleistungen beigetragen haben, zeichnet sich allgemein ab, dass die Kooperation der lokalen Akteure im Rahmen der London Challenge und ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern in Kombination mit mehr Ressourcen zu effektiveren Schulentwicklungsaktivitäten geführt haben.
Nachfolgende Reflexionsfragen sind ein Angebot, die Befunde der rezensierten Studie auf das eigene Handeln als Lehrkraft oder Schulleitungsmitglied zu beziehen und zu überlegen, inwiefern sich Anregungen für die eigene Handlungspraxis ergeben. Die Befunde der rezensierten Studien sind nicht immer generalisierbar, was z. B. in einer begrenzten Stichprobe begründet ist. Aber auch in diesen Fällen können die Ergebnisse interessante Hinweise liefern, um über die eigene pädagogische und schulentwicklerische Praxis zu reflektieren.
Reflexionsfragen für Lehrkräfte
- Wie hoch ist der Anteil an Schülerinnen und Schülern in meinen Klassen, die sozioökonomisch benachteiligt sind und/oder ethnischen Minderheiten angehören bzw. Deutsch nicht als Herkunftssprache haben?
- Welche Förderprogramme gibt es für die betroffenen Schülerinnen und Schüler auf lokaler (kommunaler) Ebene und auf Landesebene?
- Mit welchen Tests werden die basalen Kompetenzen dieser Schülerinnen und Schülern an meiner Schule ermittelt? Welche Schlüsse und Konsequenzen werden aus den Testergebnissen gezogen, um in diesen Bereichen einen Lernzuwachs zu erzielen? Welche meiner Schülerinnen und Schüler betrifft das?
- Welche Rolle spielt die Förderung der betroffenen Schülerinnen und Schüler in den von mir unterrichteten Fächern. Wie passe ich meinen Unterricht an und fördere gezielt die betroffenen Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihres individuellen Lernstands?
- Wie gelingt es mir, hohe Leistungserwartungen an die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu stellen, ohne sie zu überfordern und/oder bloßzustellen?
- Welche Fortbildungen und Angebote aus dem Unterstützungssystem meines Landes gibt es zur Förderung der betroffenen Schülerinnen und Schüler?
- Bei welchen Gelegenheiten und in welchen Gremien kann ich mich mit Kolleginnen und Kollegen über die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler austauschen?
Reflexionsfragen für Schulleitungen
- Wie arbeitet meine Schule mit den verschiedenen Akteuren der Bildungsadministration bzw. des Unterstützungssystems zusammen? Welches übergeordnete Ziel sollte im Fokus des Austausches stehen und kann dabei helfen, die Aktivitäten zu fokussieren und die Maßnahmen aufeinander abzustimmen.
- Welche Rolle spielt an meiner Schule die Förderung von Schülerinnen und Schülern aus Familien, die einen geringeren sozioökonomischen Status aufweisen und/oder einer ethnischen Minderheit angehören?
- Welche Rolle spielen Daten für die individuelle Förderung insbesondere von Schülerinnen und Schülern, die sozioökonomisch benachteiligt sind und/oder ethnischen Minderheiten zuzuordnen sind?
- Wie divers z. B. im Hinblick auf ethnische Herkunft ist das Personal meiner Schule?
Feyisa Demie bezieht sich einleitend auf Forschung zum Einfluss von Schulen auf die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler und verweist zusammenfassend auf Ergebnisse, nach denen ca. 85 % der Unterschiede in den Leistungen auf Faktoren außerhalb der Schulen zurückzuführen sind. Trotzdem gelinge es Schulen in benachteiligter Lage, die Lernergebnisse ihrer Lernenden zu verbessern, auch wenn sie nicht alle Benachteiligungen auffangen könnten. Erfolgreiche Schulen, so die Autorin, zeichnen sich durch gute Führungs- und Lehrkräfte aus, arbeiten mit den Schulbehörden und anderen Schulen zusammen, betreiben eine datenbasierte Schulentwicklung und fördern gezielt Schülerinnen und Schüler aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen. Dazu komme eine ausreichende finanzielle Ausstattung.
Demie untersucht die Entwicklung der Schulen in London im Zusammenhang mit einem großangelegten Reformprogramm in den Jahren 2003 bis 2011 mit dem Namen London Challenge. Im Rahmen dieses Programms wurden zusätzliche 80 Millionen britische Pfund in die Schulen investiert und zum Teil radikale Schulreformen bis hin zu Schulschließungen vorgenommen. Das Programm zielte darauf ab, die Ergebnisse der am meisten abgehängten Schulen zu verbessern, die Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern zu verringern und mehr sehr gute Schulen hervorzubringen. Dazu kamen spezielle Programme zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen ethnischen Gruppen.
Die Ausführungen der Autorin folgen drei Forschungsfragen:
- Wie haben sich die Leistungen an den Londoner Schulen über die Zeit verändert?
- Welche Strategien wurden angewendet, um Bildungsungleichheiten anzugehen und Schulentwicklung zu fördern?
- Welche Lehren lassen sich für Schulentwicklung aus diesem Projekt ziehen?
Zum einen werden Statistiken zu den Sekundarschulabschlüssen (GCSE) in England aus dem Zeitraum von vor dem Förderprojekt bis 2019 analysiert. Konkret geht es um die Anteile der Absolventinnen und Absolventen, die mindestens fünf Noten von A+ bis C (etwa den deutschen Noten sehr gut bis befriedigend entsprechend), einschließlich der Noten in Englisch und Mathematik, erzielten. Diese deskriptiven Auswertungen werden differenziert nach regionalen Gliederungen (Londoner Stadtgebiete bzw. London vs. England) und ethnischen Zugehörigkeiten vorgenommen. Da die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen, ergeben sich teilweise geringfügige Abweichungen und die betrachteten Zeiträume variieren. Zum anderen werden bereits publizierte Forschungsergebnisse zum Projekt einbezogen und durch die Ergebnisse aus Fallstudien ergänzt.
Veränderungen der Prüfungsergebnisse über die Jahre
Schülerinnen und Schüler der Londoner Schulen erzielten im Förderzeitraum überdurchschnittliche Verbesserungen bei den Prüfungen zum Sekundarschulabschluss (GCSE) und übertrafen am Ende die Ergebnisse im Rest von England. Dies gilt sogar für Stadtgebiete in London mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Die Verhältnisse blieben in den Folgejahren weitgehend stabil. Zudem verzeichneten ethnische Minderheiten in London erhebliche Leistungssteigerungen. Beispielsweise verwandelte sich der Rückstand von Angehörigen der schwarzafrikanischen Ethnie auf den nationalen Durchschnitt von 7 Prozentpunkten im Jahr 2003 in einen Vorsprung von 3 Prozentpunkten im Jahr 2019. Allerdings vergrößerten sich die Leistungsunterschiede nach dem Ende des Förderzeitraums teilweise wieder. So wuchs etwa der Rückstand von Angehörigen der schwarz-karibischen Ethnie von 8 % im Jahr 2013 auf 16 % im Jahr 2018.
Erfolgsfaktoren und -strategien
Als einen Erfolgsfaktor identifiziert Demie führungsstarke und anspruchsvolle Schulleitungen, die sich auf die (Verbesserung der) Qualität von Lehren und Lernen fokussieren. Ausschlaggebend seien Lehrkräfte, die gut aus- und fortgebildet sind, hohe Leistungserwartungen haben sowie adaptiv handeln und kooperieren, um Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. In ihrem Unterricht überwachen sie mithilfe von Tests den individuellen Lernfortschritt, um effektive Interventionen für alle Schülerinnen und Schüler ableiten zu können. Wichtig sei zudem eine zusätzliche Förderung in Englisch als Zweitsprache.
Darüber hinaus nennt die Autorin weitere Gelingensbedingungen: Das schulische Setting ist geprägt durch Heterogenitätssensibilität, die sich widerspiegelt in der multi-ethnischen Zusammensetzung der Beschäftigten an der Schule sowie in inklusiven Lehrplänen, die kulturelle, ethnische und sprachliche Vielfalt berücksichtigen. Den Schulen werden zusätzliche finanzielle Mittel in Abhängigkeit von der Benachteiligung der Schülerschaft zur Verfügung gestellt und das Förderprogramm ist langfristig angelegt. Entscheidend sei zudem, dass die Projektbeteiligten sich auf ein gemeinsames Ziel verpflichten und auf lokaler Ebene eng zusammenarbeiten. Das umfasst u. a. die Mitarbeitenden des Förderprogramms, die schulischen Akteure und die für Schulentwicklung Zuständigen der lokalen Behörden.
Lehren für Schulentwicklung
Demie verweist auf Forschungsergebnisse, nach denen regionale Akteure einen relevanten Beitrag zur Verringerung von Bildungsungleichheiten leisten können. In London habe es seit der Jahrtausendwende mehrere entsprechende Initiativen gegeben: London Challenge, die Ersetzung von erfolglosen Schulen durch neue Schulen und Verbesserungen bei der Unterstützung durch lokale Behörden.
In Folge hätten Londoner Schulen den höchsten Anteil von Schülerinnen und Schülern mit (mindestens) fünf guten GCSE-Noten, den höchsten Anteil von Schulen, die von der Schulinspektion als „herausragend“ bewertet werden, und die besten GCSE-Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Familien.
Demie erwähnt, dass die Verbesserungen in anderen Studien nicht primär auf die London Challenge zurückgeführt wurden, sondern auf andere Faktoren wie die effektive Nutzung von Landesmitteln zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Englisch als Zweitsprache oder den hohen Anteil an Zugewanderten mit hohen Bildungsaspirationen.
Ungeachtet dessen bilanziert sie: Während Schulen in den englischen Innenstädten häufig mit schlechten Bildungsleistungen assoziiert seien, stellten die Verbesserungen an den Londoner Schulen diesen Zusammenhang in Frage und zeigten auf, wie die Transformation mit Leidenschaft, Führungsstärke und Verpflichtung auf Lernen als zentrale Priorität und auf die Gemeinschaft, die darauf hinarbeitet, gelingen kann. Essentiell sei die Verpflichtung auf das Prinzip, dass Bildungsleistungen auf lokaler Ebene erbracht werden. Wenn Schulen veranlasst werden sollen, sich zu verbessern, gelinge das durch die Vermittlung effektiver lokaler Behörden und Projekte wie die London Challenge. So sei es möglich, eine Transformation durch gut organisierte (well-managed) und gut betriebene (well-run) lokale Behörden und Schulen herbeizuführen.
Hintergrund
Erfolgreiche Ansätze zur Förderung von Schulen in sozialräumlich deprivierter Lage und zur Verringerung von Bildungsungleichheiten adressieren ein verbreitetes und gravierendes Problem in vielen Bildungssystemen. Daher weckt die Studie von Feyisa Demie großes Interesse, denn sie beleuchtet die Erfolgsfaktoren und -strategien des Projekts London Challenge (2003–2011), mit dem öffentliche Schulen, deren Schülerinnen und Schüler anfangs besonders schlechte Schulleistungen erzielten, intensiv gefördert wurden. Hierzu analysiert sie die Entwicklung der Prüfungsergebnisse zum Sekundarschulabschluss (GCSE) und erläutert anschließend, welche Bedingungen den positiven Trends zugrunde lagen und welche Schlüsse für Schulentwicklung sich daraus ziehen lassen.
Design
Für die Analyse der Prüfungsergebnisse greift Demie auf eine große Menge an öffentlichen Statistiken zurück, die sie deskriptiv auswertet. Betrachtet werden die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die in den Prüfungen zum Sekundarschulabschluss (inkl. Englisch und Mathematik) mindestens fünfmal mit den Noten A* bis C (entspricht etwa den Noten 1 bis 3) abgeschnitten haben. Um die Ergebnisse für verschiedene Stadt- und Landesteile sowie für Angehörige unterschiedlicher ethnischer Gruppen differenziert betrachten zu können, verwendet sie Daten aus unterschiedlichen Quellen, deren Zahlen teilweise geringfügig voneinander abweichen und deren Betrachtungszeiträume variieren.
Die Ausführungen zu den Erfolgsfaktoren und -strategien stützen sich auf Ofsted-Berichte zu Schulinspektionen, Fallstudien und bereits vorhandene Forschungsergebnisse zum Förderprogramm London Challenge, deren Aussagekraft nicht direkt einschätzbar ist. Die durchgeführte Post-hoc-Betrachtung stützt sich auf deskriptive Statistiken, so dass die Ausführungen zu den Gelingensbedingungen vornehmlich auf plausiblen Annahmen beruhen und nicht als gesicherte Kausalitäten interpretiert werden können. Zudem lässt sich der Beitrag einzelner Bedingungen auf die Entwicklung der Schülerleistungen aufgrund der komplexen Gemengelage an potenziellen Einflussfaktoren bzw. -strategien nicht bestimmen.
Demie selbst führt Studien an, in denen die positiven Entwicklungen nicht primär auf die London Challenge, sondern auf andere Bedingungen zurückgeführt werden, zum Beispiel auf nationale Initiativen zur Förderung von Lese-, Schreib- und mathematischen Fähigkeiten oder den hohen Anteil an Zugewanderten mit hohen Bildungsaspirationen. Darüber hinaus wird von der Autorin kaum weitere Literatur zu Gelingensbedingungen von Schulentwicklung herangezogen.
Ergebnisse
Schülerinnen und Schüler der Londoner Schulen erzielten im Förderzeitraum überdurchschnittliche Verbesserungen bei den Prüfungen zum Sekundarschulabschluss (GCSE) und übertrafen am Ende die Ergebnisse im Rest von England. Dies gilt sogar für Stadtgebiete in London mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Angehörige von ethnischen Minderheiten konnten ihre Leistungsrückstände großteils reduzieren, wenngleich sich die Leistungsunterschiede seit dem Ende des Programms teilweise wieder vergrößert haben, wie bei Schülerinnen und Schülern, die der schwarz-karibischen Ethnie zuzuordnen sind.
Demie bewertet das Förderprogramm insgesamt als großen Erfolg und kommt zu dem Schluss, dass eine erfolgreiche Entwicklung von Schulen in sozial benachteiligten Lagen mit ethnisch diversen Schülerschaften möglich ist. Nach ihrer Einschätzung ist dafür ein ganzes Bündel an Bedingungen im Blick zu behalten und in langen Zeiträumen (hier > 10 Jahre) zu denken.
Für Bildungsadministration und Schulleitungen lässt sich nach Meinung der Autorin ableiten, dass es einerseits ankommt auf die Qualität der Schulleitungen (engagiert, anspruchsvoll, Fokus auf Lernen und Lehren), der Lehrkräfte (gut aus-/fortgebildet, hohe Leistungserwartungen, adaptives und kooperatives Handeln) und des Unterrichts (gezielte Förderung auf Grundlage von Daten zum individuellen Lernfortschritt, zusätzliche Förderung in Englisch als Zweitsprache), andererseits auf die Kooperation mit den lokalen Schulbehörden und deren Professionalität. Weiterhin spielten finanzielle Mittel zur gezielten Förderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine Rolle sowie das Bestreben der Schulleitungen, soziale Ungleichheit zu bekämpfen und die ethnische Diversität der eigenen Schülerschaft in den Lehrplänen sowie bei den in der Schule Beschäftigten zu spiegeln.
Die aufgeführten Bedingungen für die erfolgreiche Arbeit an Schulen in herausfordernden Lagen entsprechen Erkenntnissen aus der Schuleffektivitätsforschung (z. B. van Ackeren, Holtappels, Bremm, Hillebrand-Petri & Kamski, 2021) und machen deutlich, dass Schülerleistungen multideterminiert sind, wobei sich die Relevanz der einzelnen Aspekte nicht isoliert voneinander bestimmen lässt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass im Rahmen der London Challenge die intensive Kooperation der Schulen mit den lokalen Schulbehörden, die programmatische Ausrichtung und gemeinsame Verpflichtung der beteiligten Akteure auf die Förderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern sowie der damit einhergehende Austausch und die bessere Finanzierung und Nutzung von Unterstützungs- und Förderangeboten einen wichtigen Beitrag geleistet haben, um die Effektivität der Schulentwicklungsaktivitäten zur Verbesserung der Schülerleistungen zu erhöhen.
Schulentwicklung NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität NRW
Sie haben Fragen oder Anregungen?